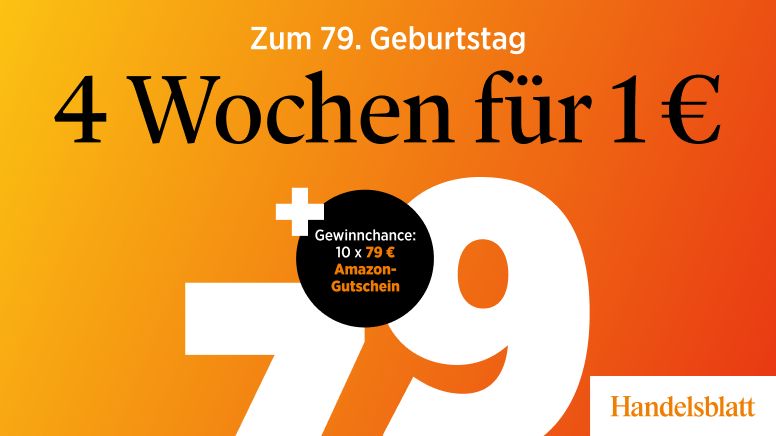Harvard-Forscher: „Es muss Toleranz für Fehler geben, aber nicht für Inkompetenz“
Kaum jemand hat sich intensiver mit Innovationsprozessen beschäftigt als Harvard-Professor Gary Pisano. Sein Credo: Innovation folgt harten Regeln – die Manager vorgeben müssen.
Berlin. Offene Fehlerkultur und Aufbruchstimmung am Kickertisch: So stellen sich die meisten Menschen innovative Unternehmen vor, sagt Gary Pisano, Ökonom an der Harvard Business School. Doch dieses Bild sei falsch und hemme Unternehmen sogar darin, gute Ideen marktfähig zu machen.
„Innovation ist kein Spaziergang, sondern das Ergebnis eines verdammt harten Prozesses“, so Pisano. Die Regeln für diesen Prozess müssten Führungskräfte festlegen – und in der Kultur ihres Unternehmens verankern.
Im Handelsblatt-Interview lesen Sie, auf welche vier Voraussetzungen es dabei laut Pisano ankommt, welche Lehren die Erfolge von Apple und Amazon für Managerinnen und Manager parat halten und welche Unternehmen in der Vergangenheit spektakulär daran scheiterten, sich rechtzeitig zu erneuern.
Lesen Sie hier das ganze Interview zum Thema Innovationskultur:
Herr Pisano, Sie betonen es in Ihren Büchern und Vorträgen immer wieder: Viele Menschen denken bei Innovation zunächst an Geistesblitze, fröhliche Brainstorming-Runden und bunte Post-its an Flipcharts. Ihnen zufolge aber liegt hinter Innovation ein knallharter Prozess. Inwiefern?
Alles, was man zum Thema Innovation liest, klingt doch in etwa so: Lasst uns Spaß haben! Lasst uns frei sein! Lasst uns Experimente machen und Fehler feiern, statt sie zu bestrafen! Es geht immer darum, dass alle miteinander kollaborieren und jeder seine Ideen äußern darf. Alles soll demokratisch sein. So ein Arbeitsumfeld lieben die Leute natürlich.
Aber?
Ich habe viele Jahre lang innovative Unternehmen erforscht. Dabei habe ich festgestellt: Natürlich haben die Menschen dort auch Spaß. Aber diese Firmen haben immer auch eine andere Seite, die weit weniger lustig ist. Sie setzen hohe Qualitätsstandards und erwarten Topleistung von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
❗️Das Handelsblatt wird 79 – und Sie feiern mit!

Was genau macht denn aus Ihrer Sicht innovative Unternehmen aus?
Es gibt meiner Meinung nach vier Voraussetzungen für Innovation. Erstens: rigorose Disziplin. Zweitens: brutale Ehrlichkeit. Drittens: eine hohe Bereitschaft des Individuums, Verantwortung zu übernehmen. Und viertens: starke Führungsfiguren.
Lassen Sie uns das mal der Reihe nach durchgehen. Was ist im Kontext von Innovation mit „Disziplin“ gemeint?
Führungskräfte in innovativen Unternehmen brauchen Disziplin, um den Widerspruch zu managen, den ich gerade beschrieben habe. Sie müssen einerseits ein Umfeld schaffen, in dem ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Freude am Experimentieren haben. Andererseits müssen sie in der Lage sein, ihnen zu sagen: „Hey, wir sollten dein Projekt einstampfen, es funktioniert so nicht.“ Es muss eine Toleranz für Fehler geben – aber bitte nicht für Inkompetenz. Das zu leben, ist für Leaderinnen und Leader nicht leicht. Denn die meisten Menschen finden Disziplin nur so lange super, bis sie ihr selbst zum Opfer fallen.
Ihr zweiter Punkt war „brutale Ehrlichkeit“. Klingt hart – was meinen Sie damit?
Innovation heißt, dass Menschen sich an etwas Unbekanntes herantasten. Dafür müssen sie Experimente machen – und einander ganz klar sagen, was funktioniert und was nicht. Sie müssen hitzige Diskussionen führen und Ideen infrage stellen oder verwerfen. Dafür die nötige Ehrlichkeit aufzubringen, schaffen viele nicht. Sie glauben gar nicht, wie oft Innovationen scheitern, nur weil Leute keine Gefühle verletzen wollen! Dabei geht es darum gar nicht. Ich habe schon Diskussionen in Unternehmen miterlebt, bei denen man von außen hätte denken können: „Um Himmels willen, diese Leute müssen sich wirklich hassen.“ Nach dem Gespräch sind die Beteiligten dann aber einfach einen Kaffee miteinander trinken gegangen. Der Trick ist, niemals etwas persönlich zu nehmen.
Gar nicht so einfach. Innovation ist schließlich in den meisten Fällen eine Gruppenarbeit, in die Befindlichkeiten, Meinungen und Erfahrungen diverser Menschen einfließen.
Und genau das ist das Problem. Viele Managerinnen und Manager verwechseln Kollaboration mit Konsens. Sie denken: Jeder sollte sich mit dem Ergebnis wohlfühlen, jeder soll mitsprechen dürfen. Aber bei Innovation geht es vor allem darum, schnell zu sein. Es braucht am Ende jemanden, der eine harte Entscheidung trifft und sagt: Wir machen jetzt X und lassen dafür Y. Und ich übernehme dafür die Verantwortung. Das ist Führungsaufgabe. Manager dürfen sich nicht hinter Gruppenentscheidungen verstecken, auch wenn das natürlich viel bequemer ist.
Wollen Sie damit sagen, dass Innovation nach Autokratie verlangt?
Ganz so hart würde ich es nicht ausdrücken. Aber Demokratie funktioniert in Unternehmen nur bedingt, gerade dann, wenn es um Innovation geht. Es braucht am Ende, nach dem Brainstorming, dem Diskutieren, dem Testen von Ideen, immer eine starke Führungsfigur. Das war mein vierter Punkt, wenn Sie sich erinnern. Leaderinnen und Leader müssen bereit sein, ins Risiko zu gehen.
Was heißt das konkret?
Wer immer nur fragt: „Hey, was möchte die Gruppe am liebsten?“, der kriegt Innovationen nie auf die Straße. Steve Jobs zum Beispiel war berühmt dafür, dass er sehr entscheidungsfreudig war. Und trotzdem bestand Apple natürlich schon damals nicht nur aus Steve Jobs, sondern aus der Summe all seiner kreativen Köpfe.
Ist diese Angst vor dem Entscheiden auch der Grund dafür, warum viele Innovationen nie den Markt erreichen?
Sie haben recht, ich habe das oft beobachtet, wenn ich Unternehmen beraten sollte. Es gibt dafür aus meiner Sicht zwei Gründe. Zum einen ist da tatsächlich die Angst vieler Managerinnen und Manager, ins Risiko zu gehen und sich mit einem Produkt wirklich rauszutrauen. Aber das Problem fängt oft schon vorher an: Meistens haben diese Managerinnen und Manager gar keine Idee, die wirklich gut ist.
Wenn ein Unternehmen wenige Innovationen hervorbringt, sind also einfach die Ideen der Mitarbeitenden schlecht?
Denken Sie doch mal an Ihr jüngstes Brainstorming. Waren die ersten Ideen, die Sie und Ihr Team da besprochen haben, direkt gut? Vermutlich nicht. Ideen werden erst im Lauf der Zeit besser – und zwar, indem man sie immer wieder infrage stellt, anzweifelt oder in Teilen verwirft. Ich nenne das „Selection Pressure“: Der Druck auf Ideen muss hoch sein, sonst bleiben sie unausgegoren. In den meisten Unternehmen aber gibt es in Diskussionen nicht genug „Selection Pressure“. Man diskutiert nicht auf eine rigorose, harte Art und Weise, sondern man diskutiert so, dass alle sich gehört fühlen und sich am Ende niemand auf den Schlips getreten fühlt.
Ist es Aufgabe von Führungskräften, diesen von Ihnen beschriebenen Druck zu erhöhen?
Definitiv. Wobei Sie nicht vergessen dürfen, dass auch Führungskräfte es andersrum aushalten müssen, wenn ihre Ideen angezweifelt werden. Davor darf sich niemand drücken, auch nicht der CEO. Ich empfehle Unternehmen immer, im Innovationskontext sogenannte Killer-Experimente durchzuführen.
Was hat es damit auf sich?
Fordern Sie Ihre Leute auf, sich gezielt ein Szenario zu überlegen, in dem Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung scheitert. Damit bringen Sie sie automatisch dazu, darüber nachzudenken, an welchen Schwächen ihre Idee krankt. Wer dieses Killer-Experiment wieder und wieder macht, muss Durchhaltevermögen beweisen. Aber am Ende haben Sie entweder eine tolle Idee, die marktfähig ist – oder die Gewissheit, dass Sie es besser sein lassen. Wir sind damit wieder bei meiner These vom Anfang: Innovation ist kein Spaziergang, sondern das Ergebnis eines verdammt harten Prozesses.
Es liegt nahe, dass Konzerne mit ihren starren Strukturen und Hierarchien es hier schwerer haben als etwa Start-ups. Welchen Einfluss hat die Größe eines Unternehmens darauf, wie innovativ es ist?
Über genau diese Annahme hat der Management-Vordenker und Ökonom Joseph Schumpeter ein Buch geschrieben, das meine Arbeit geprägt hat. Es heißt „Kreative Zerstörung“. Schumpeter ging davon aus, dass Innovation den Kapitalismus antreibt wie ein Motor: Ständig ersetzen neue Geschäftsmodelle und Technologien die alten. Unternehmen und Produkte verschwinden. Gerade große Unternehmen sind ihm zufolge gefährdet, dem zum Opfer zu fallen, weil sie träger, bürokratischer und risikoaverser sind als disruptive Start-ups. In der Vergangenheit konnte man das an vielen Beispielen beobachten.
An welchen?
Wo soll ich da anfangen? Kennen Sie noch die große DVD- und Blu-Ray-Kette Blockbuster? Hier in den USA hatten sie mal 90 Prozent der Marktanteile. Dann kamen Anbieter wie Netflix – und Blockbuster meldete Insolvenz an. Der Film-, Kamera- und Fotopapier-Anbieter Kodak litt erst unter Anbietern von Digitalkameras wie Canon oder Sony. Dann kamen auch noch die Smartphones mit integrierten Kameras dazu und machten dem Unternehmen das Geschäft kaputt. Und Handy-Anbieter Nokia hat den Trend zum Smartphone verpasst. Nokia wurde von Apple und Google verdrängt.
Wollen Sie sagen, dass dieses Schicksal für große Konzerne irgendwann unausweichlich wird?
Nein, meine Botschaft ist genau das Gegenteil! Joseph Schumpeter hat dankenswerterweise auf die Gründe aufmerksam gemacht, warum Unternehmen der „kreativen Zerstörung“ zum Opfer fallen können: Trägheit, Risikoaversion, zu große Angst um das Kerngeschäft. Aber es ist ein Missverständnis, dass große Unternehmen zwangsläufig irgendwann sterben müssen. Ich bin überzeugt: Größe muss kein Nachteil sein, wenn es um Innovation geht. Sie ist sogar eine Chance.
Inwiefern?
Ich kenne natürlich die ganzen Argumente, die gegen große Unternehmen sprechen. Sie sind oft langsame, bürokratische Tanker – in einer Welt, in der es kleine Schnellboote braucht. Aber ein großer Vorteil, den Konzerne immer gegenüber Start-ups haben werden, ist ihr Kapital. Es ist ironisch, dass viele Unternehmen so risikoscheu sind – obwohl sie finanziell eigentlich die Möglichkeit hätten, Risiken einzugehen, die ihren Aktionärinnen und Aktionären langfristig zugutekommen können.
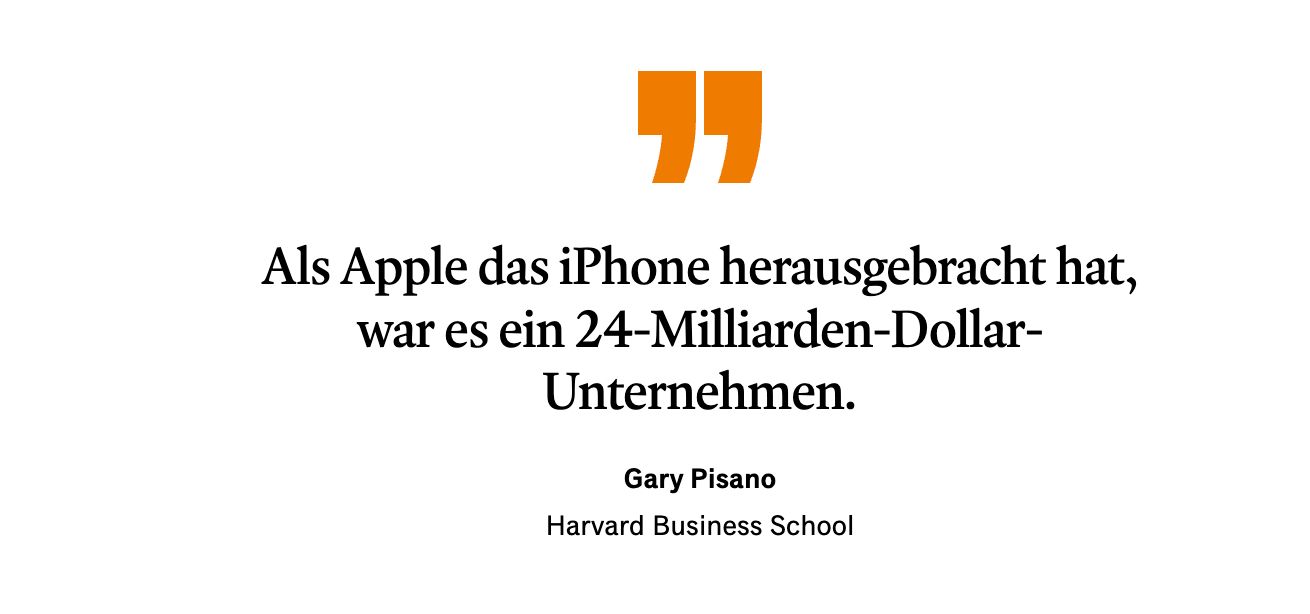
Haben Konzerne über ihre finanziellen Mittel hinaus noch weitere Vorteile?
Ein entscheidender Punkt ist auch: Die meisten Konzerne haben Expertise in allen Bereichen, die es rund um eine Innovation braucht. Start-ups haben diesen Vorteil nicht, sie müssen sich für viele Aufgaben entlang der Wertschöpfungskette Partner suchen, weil sie nicht die nötigen Ressourcen haben. Große Unternehmen dagegen können vieles aus sich heraus stemmen.
Es spricht also nichts dagegen, dass Milliardenkonzerne Disruptionen überstehen und innovativ bleiben?
Absolut gar nichts! Als Apple das iPhone herausgebracht hat, war es ein 24-Milliarden-Dollar-Unternehmen! Das vergessen die Leute manchmal. Als Amazon AWS gestartet hat, haben sie 40 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Solche Beispiele kann man in der Geschichte zuhauf finden. Sie zeigen: Ob ein Unternehmen innovativ bleibt, hängt von seiner Führungsriege ab. Sie muss sich glasklar darüber sein, wo die Ressourcen investiert werden sollen. Wie viel davon soll in neue Technologien oder Märkte fließen? Wie viel ins bestehende Geschäftsmodell? Die Führungskräfte müssen sich trauen, für diese Entscheidungen die Verantwortung zu übernehmen.
Wenn Sie Führungskräfte sagen – wen meinen Sie? Das mittlere Management? Das C-Level?
Ich sehe hier eine herausgehobene Rolle beim Topmanagement. Die oberste Führungsebene muss eine Strategie haben und sie auch verständlich kommunizieren. Sonst haben die Leute keine Vorstellung davon, worauf sie hinarbeiten. So kann keine Innovation entstehen. Top-Führungskräfte müssen hinter der Innovationskultur stehen, sie verkörpern, eine Vision in den Köpfen der Mitarbeitenden zeichnen. Das klingt vielleicht pathetisch, aber alle Mitarbeitenden im Unternehmen schauen auf die obersten Führungskräfte. In der Umsetzung spielt aber natürlich auch das mittlere Management eine wichtige Rolle. Wenn nur das Toplevel an etwas glaubt und der Rest nicht, dann wird eine Innovationskultur niemals durchdringen.
Gibt es einen Fehler, vor dem Sie Managements warnen wollen?
„Wir sind alle eine Familie“: Diesen Satz kann ich wirklich nicht mehr hören! Gerade hier in den USA schmücken sich viele Unternehmen damit, eine Familie zu sein – dabei ist ein Unternehmen eine völlig andere Organisationsform. In Firmen kommt man nicht weiter, wenn man einfach nett zueinander ist, so wie man auch nett zur Schwiegermutter ist. Außerdem sind viele Familien dysfunktional, man schweigt Probleme tot oder nimmt alles Mögliche persönlich. In Unternehmen ist das Gift, gerade im Kontext mit Innovation. Da sollte die Haltung aller Beteiligten sein: „Wenn du meine Idee kritisierst, bin ich dir nicht böse, sondern dankbar.“ Eine solche Kultur zu schaffen, ist eine der schwierigsten Führungsaufgaben überhaupt.
Herr Pisano, vielen Dank für das Interview.
❗️Das Handelsblatt wird 79 – und Sie feiern mit!