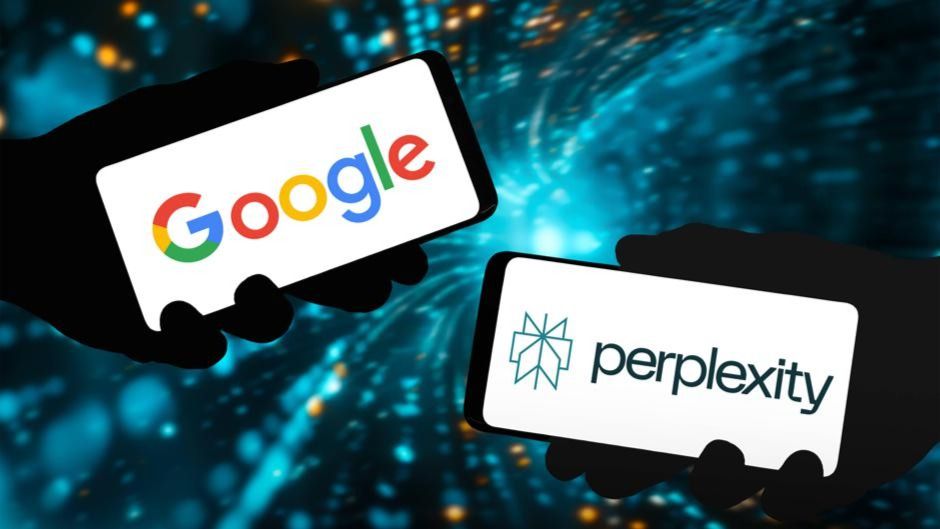Wie Werbungtreibende mit New Search umgehen
KI-Suchmaschinen experimentieren mit Werbemöglichkeiten im Umfeld ihrer Chat-Antworten. Welche Chancen bieten sich hier werbungtreibenden Unternehmen? Und wo liegen die Risiken? Eine Bestandsaufnahme.
Das Zero-Click-Gespenst geht um. Es verängstigt Publisher und Unternehmen, die auf Content setzen. Denn KI-basierte Suchmaschinen wie ChatGPT, Perplexity oder Google mit seinen AI Overviews beantworten Anfragen so ausreichend, dass die User gar nicht mehr weiterklicken. Der Informationsbedarf wird gestillt, auch wenn die Anfrage komplex war. Je nach Bereich, Endgerät und Alter der User liegt dieser Zero-Click-Anteil zwischen 45 und 70 Prozent, ein Fiasko für alle Geschäftsmodelle, die bisher mit der Weiterleitung von Google auf ihre Seiten gerechnet und dafür kräftig in SEO investiert haben.
Dies ist die eine Seite, über die gerade heftig debattiert und die an manchen Stellen juristisch ausgefochten wird. Die andere Seite: Nutzer, die sich trotzdem für einen weiteren Klick entscheiden, sind offenbar stark an ihrem Thema interessiert. Und wenn sie sich zum Beispiel gerade über ein Produkt informieren, ist die Kaufbereitschaft vermutlich weit fortgeschritten. Die Chance liegt also in der "höheren Qualität" der Klicks, so Marco Berghoff, Managing Partner bei Publicis Media. Oder, wie Torsten Köhler, Direktor Medienspezialisten bei der Pilot Agenturgruppe, es ausdrückt: "Es würde sich die Chance eröffnen, sinkende Reichweiten in klassischen Kanälen wie SEA zu kompensieren und Angebote im Moment der intensiven Recherchephase der Nutzer zu platzieren."
Noch ist es allerdings nicht so weit. Denn bislang steht Werbung im Umfeld der KI-Antworten erst am Anfang. Perplexity experimentiert in den USA derzeit mit zwei Werbemöglichkeiten: Mit Display-ähnlichen Anzeigen neben der Antwort und "Sponsored Follow-up Questions". Wenn eine Nutzerfrage gestellt wird, kann nach der Hauptantwort eine gesponserte "Folgefrage" erscheinen, die thematisch zur angefragten Thematik passt. Diese Nachfragen werden zwar als "sponsored" gekennzeichnet, aber die Antwort selbst soll weiterhin von Perplexitys KI generiert werden, ohne direkte Eingriffe durch den Werbenden. Bislang sind diese Experimente auf die USA begrenzt, allerdings gibt es Hinweise, dass auch in Europa über einen Roll-out nachgedacht wird.
Exklusiv für Xing-Premiumnutzer: HORIZONT Digital zum Sonderpreis - jetzt sichern!

Ähnliches Bild bei Google und seinen AI Overviews. Auch hier experimentiert das Unternehmen in den USA seit längerem damit, Anzeigen innerhalb seiner KI-generierten Antworten zu platzieren. In Deutschland war dies bislang nur oberhalb oder unterhalb der Antworten möglich. Allerdings mehren sich auch hier die Hinweise, dass die Markteinführung bevorsteht. Denn das Tool "AI Max for Search", eine Funktion zur KI-gestützten Optimierung von Suchkampagnen, wird offenbar weltweit zur Verfügung gestellt und wurde erst kürzlich auf der Dmexco größer präsentiert. Die Botschaft: Wenn der dahinterstehende Algorithmus es für sinnvoll erachtet, kann eine Werbung auch direkt in den AI Overviews auftauchen. Wörtlich heißt es in einem Blogbeitrag von Google: "Alle Werbetreibenden weltweit können jetzt AI Max für Suchkampagnen nutzen, eine Ein-Klick-Lösung, die das Beste der Google-KI in Ihre Suchkampagnen integriert."
ChatGPT selbst ist noch werbefrei. Allerdings testet Microsoft bei seinem Copilot sogenannte Showroom Ads und Copilot Search Ads. All das zeigt: Für Werbungtreibende tut sich gerade ein neuer Kanal auf – in einer Medienlandschaft, die ohnehin schon bis zur Unübersichtlichkeit zerklüftet ist. Die Entwicklung nimmt auch deshalb Fahrt auf, weil die großen Sprachmodelle mit ihren Business-Modellen an ihre Grenzen stoßen. ChatGPT und Perplexity werden zwar von Millionen Menschen genutzt, doch finanzieren die Abo-Modelle bei weitem nicht die laufenden Kosten. Allerdings zeigte sich auch, dass die Werbefinanzierung nicht so einfach ist. Der bei Perplexity für den Aufbau des Werbe- und Shoppinggeschäfts verantwortliche Manager Taz Patel musste im August gehen, weil sich potenzielle Kunden sehr zurückhaltend zeigen. Laut "Business Insider" betragen die Werbeeinnahmen bei Perplexity bisher nicht einmal 0,1 Prozent des Gesamtumsatzes.
"Das zentrale Risiko liegt in der unklaren Nutzerakzeptanz von Werbung in einem dialogorientierten und als persönlich empfundenen Umfeld", erklärt Köhler das Dilemma. "Für Anbieter von KI-Suchen steht die eigene Glaubwürdigkeit auf dem Spiel, wenn Antworten bewusst als kommerziell beeinflusst wahrgenommen werden. Werbetreibende wiederum riskieren geringe Klick- und Verkaufszahlen, falls die Anzeigen als störend wahrgenommen werden." Demgegenüber stehen die Momente der hohen Aufmerksamkeit. "Wenn Werbung stärker in kontextuelle Dialoge eingebettet wird, eröffnet das Werbetreibenden die Chance, ihre Marken genau an dem Punkt sichtbar zu machen, wenn Entscheidungen getroffen werden", sagt Michael Fuhrmann, RVP DACH & CEE bei DoubleVerify.
Allerdings kann man in diesem kontextuellen, sensiblen Umfeld mit seiner Werbebotschaft auch schnell danebenliegen. Wer es nicht schafft, sein Angebot auf die offenbar gerade so drängenden Userfragen auszurichten, macht sich unbeliebt, gilt als Störenfried. Sollten Werbekunden öfter danebenliegen, könnte auch das Image der KI-Suchmaschine leiden. Umgekehrt ist es für Markenartikler bei der ganzen Komplexität der möglichen Suchanfragen schwierig, immer zielsicher aufzutauchen. "Gerade in dynamischen, KI-generierten Antworten ist der Kontext oft schwer vorhersehbar", so Fuhrmann. "Dadurch steigt die Gefahr, dass Marken in unpassenden Umfeldern erscheinen und das Markenimage beeinträchtigt werden kann."
Vor diesem Hintergrund erklären sich sowohl die langsame Einführung der Werbemöglichkeiten wie auch die Zurückhaltung der Händler und Markenartikler. Dabei, so findet Dennis Beivers, Director Sales DE/AT bei Readpeak, wäre Mut durchaus angebracht. "Weil sich dieser Kanal noch im Aufbau befindet, bietet er First Movern die Chance, Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit langfristig zu sichern, vor allem für Content-orientierte Markenstrategien. Soll heißen: Unternehmen, die unter dem Zero-Klick-Phänomen leiden, könnten genau in diesen Umfeldern neue Chancen finden.
AI Overviews: So nutzt Google KI in der Suche
Google zeigt seit 2024 auch in Deutschland sogenannte AI Overviews an – automatisch generierte Zusammenfassungen von Suchergebnissen. Sie basieren auf dem Gemini-Sprachmodell und kombinieren Inhalte aus mehreren Quellen zu einer kompakten Antwort. Damit verändert sich die klassische Suchergebnisseite: Nutzer sehen nicht mehr nur eine Linkliste, sondern erhalten direkt eine inhaltliche Übersicht. Werbung ist in Deutschland bislang nicht innerhalb der Overviews möglich. Anzeigen erscheinen nur ober- oder unterhalb der KI-Blöcke. Tests mit Anzeigen in den Overviews laufen derzeit ausschließlich in den USA.
Allerdings bestehen für Werbungtreibende noch weitere Herausforderungen – neben dem sensiblen Umfeld und den eingeschränkten Werbemöglichkeiten. Die zunehmende Fragmentierung des Marktes führt dazu, dass den einzelnen Kanälen immer weniger Budgets zur Verfügung stehen. Damit werden gleichzeitig vergleichsweise wenige Daten produziert, die wiederum für erfolgreiche Kampagnen nötig sind. "Wenn aber weniger Daten in jeden einzelnen Kanal fließen, wird dies einen negativen Effekt auf die algorithmusbasierten Bidding-Strategien haben", erklärt Marco Berghoff. "Mit weniger Daten dauert es länger, um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, was die Qualität der Entscheidungsgrundlagen beeinträchtigen kann." Diese Verzögerung kann dazu führen, dass Kampagnen nicht so schnell optimiert werden, wie das eigentlich nötig wäre. Die Folge: Das Potenzial der neuen Werbemöglichkeiten wird nicht ausgeschöpft.
Vielleicht aber ist diese Mensch-Maschine-Interaktion ohnehin nur ein kurzer Moment in einer Entwicklung, die sich in eine ganze andere Richtung dreht. Nicht wenige KI-Experten sprechen derzeit davon, dass schon bald digitale Assistenten unsere Einkäufe im Netz übernehmen. Das soll dann so gehen: Ein User beauftragt einen KI-Agenten damit, ein für ihn passendes Produkt zu kaufen. Dazu legt er seine Vorlieben und eine Preisspanne fest. Der persönliche KI-Assistent durchforstet daraufhin das Internet, interagiert mit Sprachmodellen und lässt sich von Werbebotschaften im Umfeld nicht beeinflussen. "KI-gestützte Suche und Assistenten werden die Beziehungen zwischen Marken und Konsumenten radikal verändern", prognostiziert Julian Kramer, Principal Thought Leadership bei Adobe Central Europe. "Marken gehen künftig womöglich nicht mehr direkt zum Kunden, sondern müssen ihre Datenquellen so aufbereiten, dass die KI-Agenten der Nutzer darauf zugreifen können."
Exklusiv für Xing-Premiumnutzer: HORIZONT Digital zum Sonderpreis - jetzt sichern!