500-Milliarden-Sondervermögen: Wer jetzt auf Fördergelder hofft
Das 500 Milliarden Euro schwere Förderprogramm für die Infrastruktur der wahrscheinlich künftigen Bundesregierung weckt Begehrlichkeiten. Mögliche Profiteure bringen sich in Stellung.
Union und SPD haben sich – schon vor Abschluss der Sondierungsgespräche am Samstag – auch auf ein gigantisches Infrastrukturprogramm verständigt. Dafür soll ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für die Dauer von zehn Jahren geschaffen werden. Zwar kann das Vorhaben noch im Bundestag, im Bundesrat oder an einem Votum des Bundesverfassungsgerichts scheitern. Die Chancen stehen aber gut, dass das in dieser Höhe einzigartige staatliche Investitionsprogramm tatsächlich kommt.
Vieles ist allerdings noch unklar: Welche Branchen werden von dem Programm am meisten profitieren? Welche Unternehmen kommen zuerst zum Zug, welche müssen sich gedulden und welche werden womöglich leer ausgehen, obwohl sie relevante Anbieter im Bereich der Infrastruktur sind? Unternehmen bringen sich schon in Stellung, melden Ansprüche an und brüten über Möglichkeiten, um an den prall gefüllten Investitionstopf zu kommen.
Bauwirtschaft: Wende schon 2025
Bei Infrastruktur denken viele Menschen zuerst an die Bauwirtschaft. Und das nicht zu Unrecht, denn ohne Baumaßnahmen sind die wenigsten Eingriffe in die Infrastruktur umzusetzen. Das sieht – naturgemäß – auch Peter Hübner, Präsident beim Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) und Vorstand beim Baukonzern Strabag, so: „Bauen muss der Grundpfeiler für ein neues Wachstumskonzept in Deutschland sein“, sagt er. Der Bau sei ein Motor für die Binnenkonjunktur: „Wir modernisieren den Wirtschaftsstandort und werden gebraucht, um die Verteidigungsfähigkeit wieder herzustellen oder Wohnraum zu bauen.“
Im Bausektor ist das staatliche Geld nach Ansicht des Verbands gut investiert. Jeder Euro, der in Infrastruktur investiert wird, sagt Hübner, löse 2,50 Euro Wachstumsimpuls aus. Um konjunkturelle Impulse schnell auszulösen, empfiehlt Hüber den Straßenbau: Der Bund solle die Autobahngesellschaft bereits 2025 mit zusätzlichen 1,5 Milliarden Euro ausstatten, „damit bereits fertige Ausschreibungen umgehend an den Markt kommen, für die bisher das Geld fehlt“.
Beim Wohnungsbau und den Mieten könne Deutschland den Turnaround schaffen. „Ich lehne mich aus dem Fenster: Dass wir den Rückgang bei den Baugenehmigungen stoppen, ist bis zum 4. Quartal 2025 machbar“, sagt Hübner.
Stahlindustrie: Strohhalm für die gebeutelte Branche
Für die deutsche Stahlindustrie könnten die geplanten Investitionen in die Infrastruktur zum Rettungspaket werden. Die Branche ist arg gebeutelt. Der Einbruch in der Automobilindustrie hat strukturell für erheblich Druck gesorgt. Dazu drücken schlechte Konjunktur und niedrige Preise die Ergebnisse. Und bei jenen Unternehmen wie die Thyssenkrupp-Tochter Steel Europe, die Salzgitter AG oder die Stahl Holding Saar (SHS), die mit milliardenschweren Staatshilfen in den Umstieg von der Co2-intensiven Hochofenroute auf Direktreduktionsanlagen investiert haben, ist die Stimmung zusätzlich gedämpft. Denn der Wasserstoff kommt später als erhofft und wird teurer als erwartet.
Deshalb ist die Hoffnung hier ohnehin, dass eine neue Regierung die Vorgaben so lockert, dass die neuen Anlagen länger als bisher geplant mit Erdgas befeuert werden können. Die Aktie der Salzgitter AG legte nach der Verkündung am Dienstagabend zeitweise um über 25 Prozent zu, stieg von 20,22 Euro auf bis zu 25,72 Euro am Donnerstag. Das ist insofern relevant, weil zwei Familienunternehmen – die Remondis-Tochter TSR sowie das Bauunternehmen GP Günter Papenburg AG – erwägen, die Mehrheit des Konzerns zu übernehmen. Das dürfte nun deutlich teurer werden.
👉 Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen
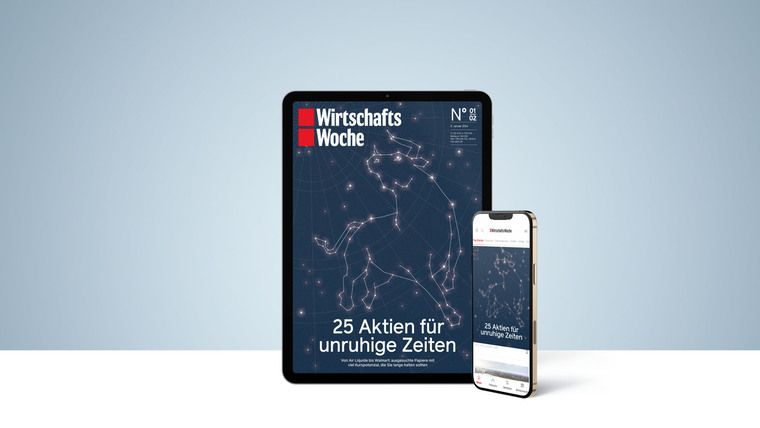
Noch sind alle Unternehmen vorsichtig, die Auswirkungen auf ihr Geschäft öffentlich konkret zu analysieren. Aber von der Salzgitter AG heißt es: „Wir sehen einen positiven Schub für unsere Produkte und damit auch eine Bestätigung unserer Strategie breit aufgestellter Konzernprodukte für die Bereiche Automotive, Infrastruktur, Energie sowie Verteidigung.“ Bei Bedarf könne man Kapazitäten schnell ausweiten. Von der Stahl Holding Saar heißt es: „Die von Union und SPD angestrebten zusätzlichen Ausgaben werden voraussichtlich eine positive Auswirkung auf die Stahlnachfrage insgesamt haben. Für die genannten Segmente ist Stahl ein wesentlicher Grundstoff.“ Allerdings hingen die konkreten Auswirkungen „vom zeitlichen Rahmen und der konkreten Ausgestaltung der Einzelinvestitionen ab.“
Bahnindustrie: 33.000 Kilometer Platz für Investitionen
Im Bereich der Schiene ist die Erleichterung über den möglichen Geldsegen deutlich zu spüren. „Es ist langsam dem Letzten klar, dass wir über Jahrzehnte hinweg die Schiene vernachlässigt haben“, sagt Sarah Stark, die Geschäftsführerin des Verbandes der Bahnindustrie. Aus ihrer Sicht hat bereits die Ampelkoalition den richtigen Weg eingeschlagen. Unter Verkehrsminister Volker Wissing hat die Bahn begonnen, besonders belastete Strecken grundlegend zu sanieren. 41 Korridore sollen so bis 2030 erneuert werden. Wissing hatte im vergangenen Jahr der Bahn 18 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Zu tun bleibt genug: Es werde nicht reichen, „wenn wir uns nur auf die Generalsanierungen konzentrieren. Wenn wir eine verlässliche Bahn wollen, müssen wir auch die Fläche erneuern“, so Stark. Das Bahnnetz in Deutschland sei schließlich 33.000 Kilometer lang. Die Projekte dürften der Industrie so schnell also nicht ausgehen.
Luftfahrt: Neue Chancen für den Lufthansa-Heimatmarkt
Der Gewinn der Lufthansa hat sich im vergangenen Jahr nahezu halbiert. Einer der Gründe hat mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland und seiner Infrastruktur zu tun. Im laufenden Jahr werde man voraussichtlich erstmals „unter 20 Prozent“ des Umsatzes im Heimatmarkt Deutschland machen, erklärte Lufthansa-Chef Carsten Spohr auf der Bilanzpressekonferenz des Unternehmens am Donnerstag. „Wenn nichts passiert, wird Deutschland im europäischen Vergleich abgehängt“, sagt Spohr. „Für Lufthansa ist das verkraftbar, wir wachsen dann woanders.“ Aber natürlich bleibe der deutsche Markt relevant.
Auch wegen der am Mittwoch verkündeten politischen Einigung auf ein Sondervermögen hoffe er aber, so Spohr, dass sich das Wirtschaftswachstum in Deutschland wieder ins Positive drehe – und damit auch das Heimatgeschäft der Lufthansa. „Ich hoffe, dass wir das Potenzial unseres Landes wieder besser nutzen können. Dann wird auch der Anteil des deutschen Markts an Umsatz und Gewinn bei der Lufthansa wieder steigen.“
Spohr richtete in diesem Zusammenhang auch einen Appell nach Berlin: Der Luftverkehr sei eine der wenigen Zukunftsbranchen, in denen der Wirtschaftsstandort Deutschland noch eine führende Rolle spiele, sagte der Lufthansa-Chef. „Dass wir das nicht aufs Spiel setzen, dafür brauchen wir Hilfe. Und zwar von denjenigen, die uns durch immer neue Regularien im internationalen Wettbewerb immer mehr bachteiligen.“ Die Vorgaben der EU an die europäische Luftfahrt seien teils „technisch nicht realistisch“, sagte Spohr. Es liege jetzt auch an der neuen Regierung, in Brüssel Änderung anzuschieben.
Technologie: Bloß nicht mit der Gießkanne!
Der Technologiekonzern Siemens mit seinen Geschäftsbereichen Industrie, Infrastruktur und Mobilität darf sich beste Chancen auf Fördermilliarden ausrechnen. Intern dürften die Beratungen längst begonnen haben, wie der Konzern an die Mittel kommen kann. Grundsätzlich lobt der Konzern „die geplanten Investitionen in Straßen, Schienen, Energienetze und digitale Infrastruktur“ – sie seien dringend nötig. „Das geplante Volumen in Höhe von 500 Milliarden Euro und die Laufzeit über 10 Jahre schaffen Planungssicherheit“, heißt es bei Siemens.
Wichtig ist nach Auffassung des Konzerns, dass das Sondervermögen zusätzliche Mittel bereitstellt und nicht bestehende Investitionen ersetzt. Zudem müsse das Geld „effizient und schnell“ fließen: „Planungs- und Genehmigungsverfahren müssen deutlich beschleunigt, private Investitionen, etwa in industrielle 5G-Netze, aktiviert und erleichtert werden“, sagte ein Siemens-Sprecher gegenüber der WirtschaftsWoche. Angesichts des öffentlichen Investitionsstaus in Höhe von rund 600 Milliarden Euro sei „allerdings auch weiterhin eine kostenbewusste Priorisierung und effiziente Koordinierung der Investitionen unerlässlich“.
Der Konzern spricht damit einen wichtigen Punkt an: Investitionsmöglichkeiten gibt es zur Genüge – die Politik muss sicherstellen, dass das Geld nicht mit der Gießkanne über dem ganzen Land vergossen wird und wirkungslos versickert, sondern an die besonders wichtigen Projekte geht, die einen hohen Nutzen für das Land haben, die schnell umzusetzen sind oder weitere, private Investitionen auslösen.
👉 Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen
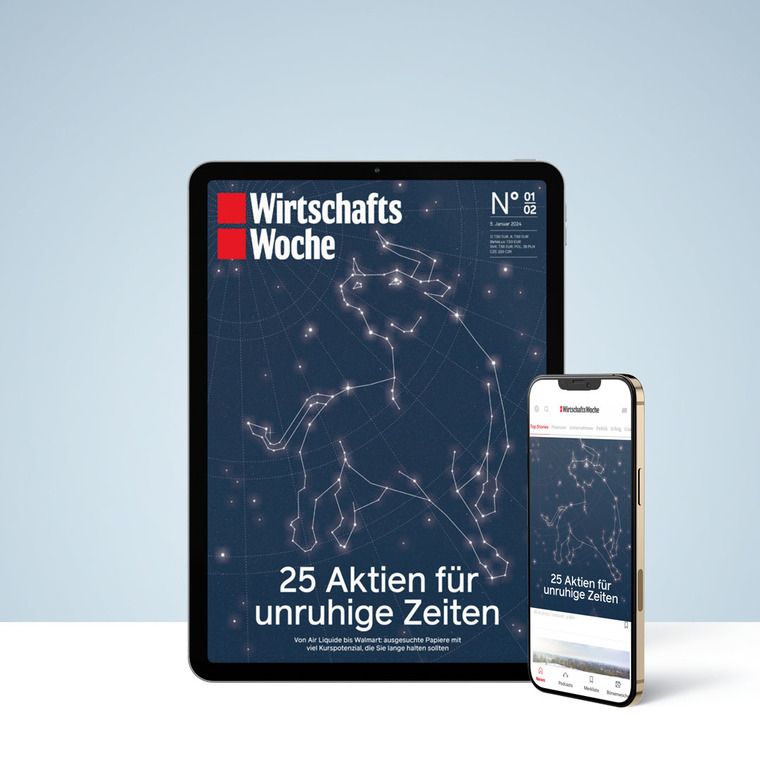
👉 Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen

