Airbus Wasserstoffjets: Der Öko-Flieger bleibt vorerst ein Traum
Das vorläufige Aus des Airbus-Wasserstoffjets stoppt die Illusion, klimaneutrales Fliegen sei leicht zu machen – und stellt die Politik vor ein Dilemma.
Eine Abendveranstaltung auf einer Dachterrasse in Paris. Airbus-Chef Guillaume Faury schwärmt von der „vierten Revolution“ der Luftfahrt, dem klimaneutralen Fliegen mit Wasserstoffantrieb. Ab 2025 solle die Motorentechnik feststehen, kündigt er an. Vier Jahre später sei der Prototyp eines Wasserstofffliegers fertig. 2035 könnten dann die ersten Linienflüge starten.
Im Juni 2023 war das. Inzwischen dürfte Faury seine Äußerungen bereuen. Denn es ist nun klar: Das klimafreundliche Fliegen bleibt vorerst ein Traum. Der Luftfahrtkonzern schob das Wasserstoff-Projekt in der vergangenen Woche klammheimlich auf die lange Bank: Statt des Unternehmens meldete die Gewerkschaft Force Ouvrier am vergangenen Freitag erbost, der Konzern habe die „Prioritäten überdacht“ und darum „die Einführung von Wasserstofftechnologien um fünf bis zehn Jahre verzögert“ sowie die Flugtests und „mehrere Unterprojekte beendet“. Später moderierte dann auch der Konzern die „vierte Revolution“ ab.
Daseinsberechtigung für die Zukunft
Das vorläufige Aus des Ökojets wirkt wie ein harter Schlag, denn Antriebe mit Wasserstoff statt Kerosin waren die größte Hoffnung, klimaneutral zu fliegen. Doch tatsächlich ist es das wenig überraschende Ende der Illusion, die Branche könne ihre Umweltziele ohne grundlegende Veränderungen erreichen.
Das Fliegen ohne umweltschädliche Emissionen ist die derzeit wichtigste Herausforderung der Branche. „Nur wenn uns das gelingt, verdienen wir auch weiterhin unsere Daseinsberechtigung für die Zukunft“, sagte Sabine Klauke, Technik-Chefin von Airbus, im Herbst 2022. Der Konzern kündigte damals den Wasserstoffjet an und erprobte ein Testtriebwerk an einem umgebauten Superjumbo A380. Klappt es nicht mit dem Umstieg auf klimafreundliche Technologien, werde es eng für Hersteller und Fluglinien, warnt Florian Dehne, Partner bei der Beratung Roland Berger: „Schafft es die Flugbranche nicht, ihre Klimabelastung wie versprochen deutlich zu mindern, drohen spürbare Einschränkungen.“ Auch Flugverbote seien möglich.
Das Ziel erscheint jedoch zunehmend unerreichbar. Denn die Fliegerei ist derzeit eine der wenigen Branchen, die trotz aller Anstrengungen Jahr für Jahr mehr Kohlendioxid ausstößt. Das rührt vor allem daher, dass die Nachfrage und mit ihr die Zahl der Flüge schneller wachsen als neue energiesparende Jets den Ausstoß bremsen. Und nachhaltig erzeugte Kraftstoffe gibt es so wenige, dass sie praktisch keinen Einfluss haben.
Echter Hydrogen-Hype
Mit Wasserstoff erschien das Ziel hingegen zum Greifen nah. Das Element lässt sich mit billiger Sonnenergie im großen Stil klimafreundlich und günstig herstellen. In den Flugzeugmotoren verbrennt es praktisch rückstandsfrei zu Wasserdampf. Kerosin dagegen belastet die Atmosphäre mit dem Treibhausgas Kohlendioxid. Prompt ging eine Art Hydrogen-Hype durch die Luftfahrt. Denn neben Airbus starteten auch andere Projekte, etwa der Billigflieger Easyjet mit dem britischen Triebwerkshersteller Rolls Royce.
👉 Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen
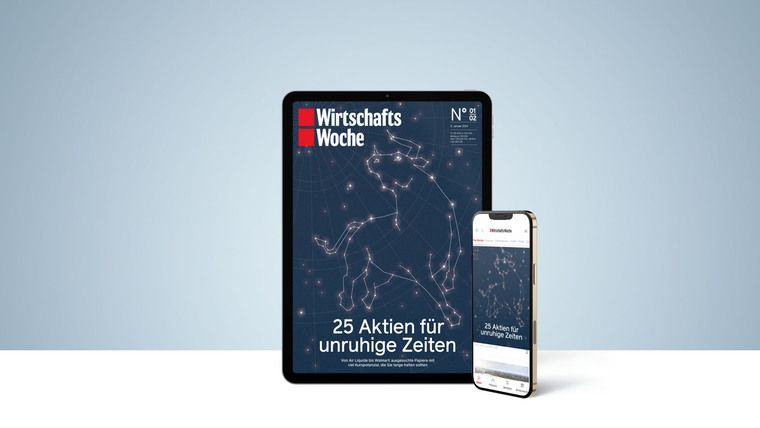
Und lange sah es gut aus. „Rein technisch ist ein Wasserstofftriebwerk machbar“, beschrieb Rolls-Royce-Chefingenieur Jorg Au die Erfolge seiner Forscher noch im vergangenen Sommer.
Doch leider waren außer den Motoren alle anderen Teile des Systems umso schwerer zu lösen. Das beginnt bei den Leitungen, die den Treibstoff vom Tank zum Motor bringen. Denn flüssig ist Wasserstoff nur zwischen minus 259 und 252 Grad Celsius. Kaum weniger anspruchsvoll ist die Lagerung im Flieger. Die Temperatur halten können nur Speicher, die wesentlich größer und schwerer sind als heutige Kerosintanks.
Zudem ist Wasserstoff schwer zu bändigen. Die Atome sind so klein, dass sie aus fast allen Materialien entweichen. Dazu ist das Element chemisch schwer zu bremsen, weil es sich gern mit anderen Stoffen verbindet, was zu Korrosion oder sogar Explosionen führen kann.
Daher ist es wenig verwunderlich, dass es nicht einfach ist, die für die Technik nötigen Genehmigungen der Behörden zu bekommen. Sie schauen bei Innovationen besonders genau hin – gerade auch nach den Abstürzen der Boeing 737 Max, bei denen offenbar eine nicht ausreichend durchdachte Erfindung eine Rolle spielte.
Übermächtige Herausforderung
Diese Widerstände waren es wohl, die Airbus zum Zurückrudern bewog. Wasserstoff könne zwar „transformative Energiequelle für die Luftfahrt sein“, heißt es in der Absage. „Wir erkennen aber, dass die Entwicklung eines Wasserstoff-Ökosystems inklusive Infrastruktur, Produktion, Verteilung und eines regulatorischen Rahmens eine riesige Herausforderung ist, die weltweiter Zusammenarbeit und Unterstützung bedarf.“ Auch gebe es auf absehbare Zeit zu wenig Wasserstoff aus erneuerbaren Energiequellen. Darum wolle der Konzern zwar weiterhin „ein kommerziell erfolgreiches, vollelektrisches und von Wasserstoff angetriebenes Flugzeug auf den Markt bringen“, doch wann und wie bleibt die Erklärung schuldig.
So gilt also bis auf weiteres: Statt Wasserdampf nur heiße Luft. Das ist für Airbus, den Rest der Branche und vor allem die Politik ein Dilemma.
Zwar glaubte auch bisher niemand aus tiefster Seele, dass die Luftfahrt 2050 wirklich klimaneutral fliegt. Aber die Aussicht auf Wasserstoffflieger ab 2035 habe zumindest Hoffnung gemacht, dass es irgendwann danach was wird, heißt es in der Branche. Nun aber sieht man zwei Szenarien: Entweder die Politik bremst die Luftfahrtindustrie durch steigende Umweltauflagen, erschwert und verteuert also das Fliegen. Oder sie zeigt sich bei den Umweltauflagen gnädig und unterstützt die Flugzeughersteller bei der Suche nach klimaverträglicheren Lösungen – etwa mit Subventionen zur Herstellung nachhaltiger Treibstoffe, Unterstützung der Forschung zu sparsameren Flugverfahren oder Forschungsmitteln für neue Flugzeuge.
Denn eine neue Generation deutlich sparsamerer Flugzeuge rechnet sich aus Sicht der Hersteller frühestens Ende der 2030er-Jahre – und damit kaum vor dem Wasserstoffjet.
Keine leichte Entscheidung.
👉 Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen
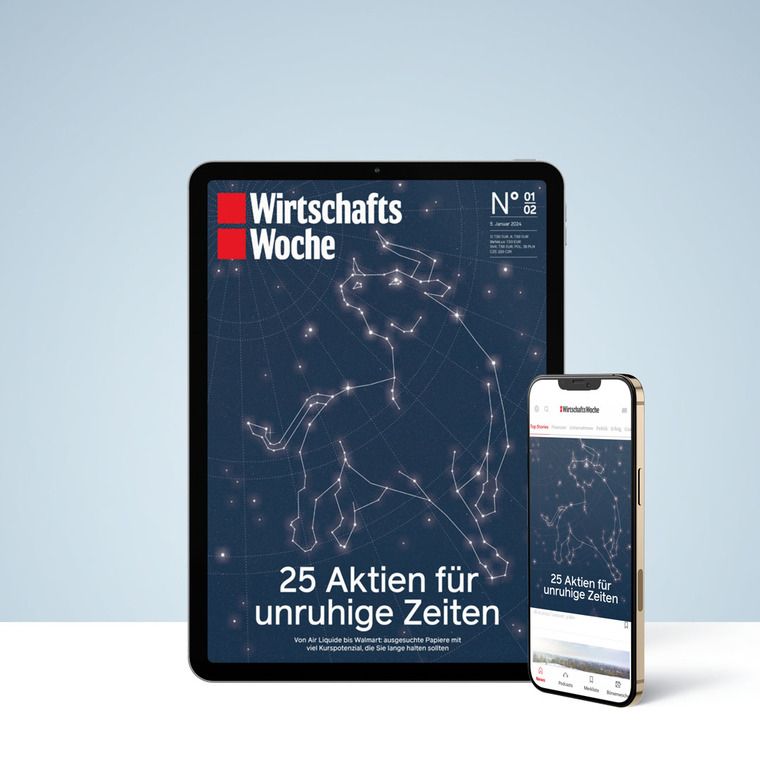
👉 Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen

