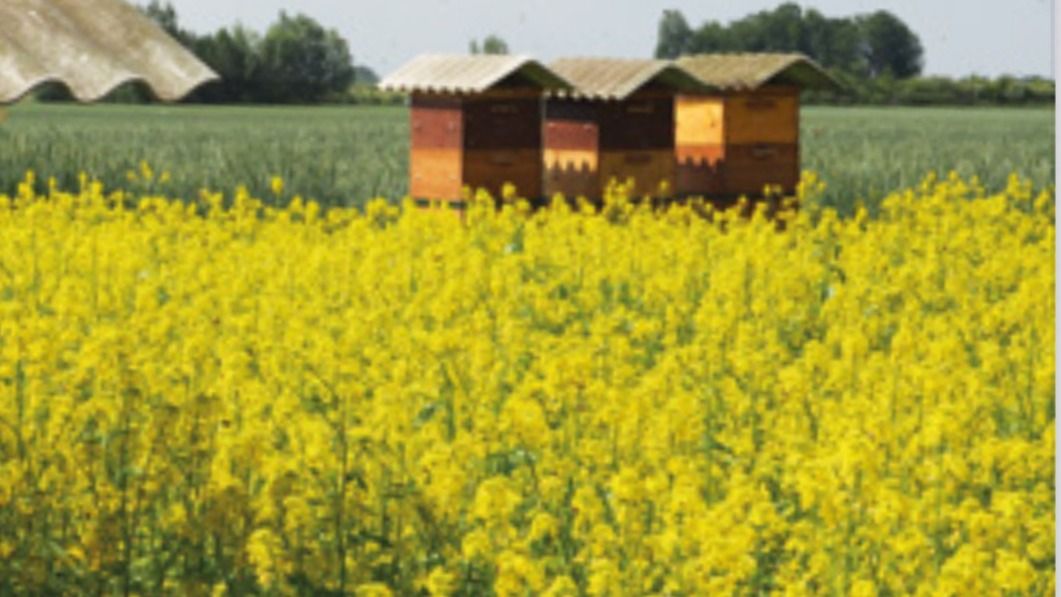Auf dem Boden der Tatsachen: „Regionalität darf nicht zu Gunsten von billigen Preisen geopfert werden“
Globale Herausforderungen für ein friedliches und gerechtes Zusammenleben können nur durch regionale Strukturen gewährleistet werden - mit einem gesunden Boden, der die Grundlage der Landwirtschaft und zentral für eine zukunftsfähige Entwicklung ist.
Der Boden ist unsere Lebensgrundlage: Er ist CO2-Speicher, Wasserspeicher und Nährstofflieferant. Auch Klima, Artenvielfalt und Ernährungssicherheit werden durch ihn geschützt. Es ist deshalb wichtig, die lokalen Gegebenheiten wie Klima, Bodenbeschaffenheit, Wasserverfügbarkeit und die kulturellen Traditionen vor Ort zu kennen, um die landwirtschaftlichen Praktiken richtig darauf abzustimmen. Allerdings wird er uns heute vielfach unter den Füssen weggezogen: unter anderem durch Versiegelung, Erosion und Übernutzung, Antibiotika aus der Massentierhaltung, Pestizide, Chemikalien, Kunstdünger, Schwermetalle und Plastik. Auch wurden in den vergangenen Jahren aus vielen komplexen Anbausystemen Monokulturen gemacht.
Diese auf maximale Erträge ausgerichteten Produktion führt zu anfälligen Agrarökosystemen. Das hat Folgen für alle: Werden die Böden beschädigt, steigen beispielsweise die Kosten für die Wasseraufbereitung - und wir zahlen letztlich drauf. Verödete Ackerflächen sind mit steigenden Kosten für Dünger, Bewässerung und Bearbeitung verbunden. Durch vielfältige Fruchtfolgen und den gezielten Anbau von Zwischenfrüchten verbessert sich die Bodenqualität. Auch das Risiko von Erosionen wird minimiert. Pflanzenvielfalt hemmt die Ausbreitung von Schädlingen und Krankheiten, sodass weniger Pestizide eingesetzt werden müssen.
Fruchtbare Böden sind lebenswichtig.
Über 90 Prozent aller Nahrungsmittel entstehen im, auf oder durch den Boden. Ihn zu schützen, ist deshalb dringlich, wenn die Ernährung für künftige Generationen gesichert werden soll. Dafür braucht es einen artenreichen Anbau, der die Biodiversität fördert und den Boden verbessert, die Überwindung der Kluft zwischen Konsumenten und Landwirten sowie die Förderung des Kaufs von guten Lebensmitteln. Zudem sollte die Politik sollte den Boden rechtlich schützen.
Auch in den 17 Sustainable Development Goals (SDGs) spielen Böden bzw. Landflächen - zumindest implizit - eine herausragende Rolle. Das betrifft beispielsweise die Ziele zur Ernährungssicherheit (SDG 2), Energieversorgung (SDG 7), Produktion und Konsum (SDG 12) sowie zur nachhaltigen Nutzung der Ökosysteme (SDG 15). Die landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland sind nicht nur Versorger, sondern auch Landschaftspfleger, Arbeitgeber und Innovatoren im ländlichen Raum. Inzwischen übernehmen auch viele konventionell wirtschaftende Betriebe nachhaltige Ansätze (z.B. im Bodenmanagement, beim Pflanzenschutz oder in der Tierhaltung). Auch wird vielfach regenerative Landwirtschaft mit konventioneller Technik vereint.
Leider werden „viele Nahrungsmittel quer durch Europa gefahren. Gleichzeitig haben es Direktvermarkter oft schwer, ihre Produkte regional zu verkaufen oder bei den Lebensmittelketten vor Ort einen angemessenen Absatz zu erzielen. Honoriert würde es werden, wenn man mit geringem Kostenaufwand vermarkten kann“, sagt Landwirt Stefan Bergmair. Die guten Produkte müssen seiner Ansicht nach teurer verkauft werden, „denn sie haben einen anderen Wert als billige Massenware.“
Der Familienbetrieb aus dem Wittelsbacher Land im Bayerisch Schwaben hat sich unter anderem auf den Anbau von Senf als Kulturpflanze spezialisiert: Vor über zehn Jahren begann er, mit dem Senfanbau zu experimentieren - auch mit unterschiedlichen Sorten wie dem gelben, braunen und orientalischen Senf. „Wir sammelten viel Erfahrung und bauen heute jährlich etwa 25 ha Senf als Sonderkultur an. Der Senf verlangt Fingerspitzengefühl und Geschick im optimalen Saatzeitpunkt, bei der Ernte (der Senf hat ca. sechs Körner pro Schote, zum Vergleich: eine Rapspflanze zwischen 10 bis 20) und in der Vermarktung.“
Senf fördert die Bodenqualität und Gesundheit.
Das Logo des Familienunternehmens ist an den Senfanbau angelehnt: Es trägt die gleiche Farbe, goldbraun und verweist darauf, dass der Senf auch häufig das „i-Tüpferl“ auf dem Essen ist. „Das Konzept ist gestützt auf die Verfeinerung der Lebensmittel, qualitative Nahrung und Förderung der regionalen Landwirtschaft.“ Das vermeintlich Kleine und Nebensächliche ist hier von größter Bedeutung. Das Hauptproblem ist allerdings, „dass die großen deutschen Senfhersteller den Senf dort kaufen, wo er billig ist -, und das ist nicht in Deutschland. Hier wird die Regionalität zu Gunsten von billigen Preisen geopfert“, so der Landwirt.
Das Familienunternehmen arbeitet eng mit kleinen, regionalen sowie großen, überregionalen Senfherstellern zusammen und beliefert diese mit ihrem landwirtschaftlichen Produkt. Der Senf trägt das Siegel „Geprüfte Qualität Bayern“. Seine Frau, Renate Bergmair, ist sehr kreativ in der Küche und entwickelt unterschiedliche Produkte und Rezepte rund um die Pflanze Senf. „Senfkörner sind in der Küche vielseitig einsetzbar: zum Würzen und Einlegen von Marinaden und Gemüse, als Ersatz für Salz, in der Zubereitung von Suppen und Eintöpfen sowie von Fleisch- und Fischgerichten. Die Körner entfalten erst nach und nach ihr scharfes Aroma“, sagt Renate Bergmair. Das hochwertige Senföl (gelb) ist angenehm mild im Geschmack und bis 240°C erhitzbar. 2Es ist deshalb ideal zum Braten und Frittieren sowie für die kalte Küche (Salate) bestens geeignet.“
Ihre Tochter, Christine Bergmair, wurde von klein auf in die betrieblichen Entwicklungen eingebunden.
Das Getreidelagermanagement in der Erntezeit übernahm sie bereits in jungen Jahren. Sie führt das Familienunternehmen in die neue Generation und vernetzt die Themen mit Gesundheit, Genuss und Freude – das betrifft auch Produktion und Weiterentwicklung der Eigenvermarktung: „Wir teilen die Leidenschaft für die Natur, ihre Erzeugnisse und qualitative Lebensmittel. Fruchtbare Böden und gesundes Pflanzenwachstum sind die Basis für unser Leben und unsere Entwicklung. Die Zukunft liegt in unseren Händen und in unseren Nahrungsmitteln.“
Die Gründerin und Geschäftsführerin des Gesundhaus i-Tüpferl, das ebenfalls zum Familienunternehmen gehört, verweist auch auf die gesundheitsfördernden Eigenschaften der Senfpflanze: „Die ätherischen Öle im Senf wirken antibakteriell und bringen die Verdauungssäfte in Schwung. Sie sind durchblutungsfördernd, wärmend und schleimlösend und finden daher Anwendung in vielen Hausmitteln.“ So helfen Senfmehlwickel beispielsweise bei Bronchitis. Senfmehl eignet sich gut zum Herstellen von Wickeln oder zum Baden (Fuß- oder Vollbad). Es kann aber auch zur Düngung und Desinfektion von Blumentöpfen und Beeten im Garten benutzt werden: „Im Garten kann das Mehl zur Entgiftung des Bodens zwei Wochen vor dem Bepflanzen in die Erde eingearbeitet werden. Dem Boden werden so wichtige Nährstoffe zurückgeführt.“
Der Senf ist deshalb eine nachhaltige Pflanze, die häufig als Zwischenfrucht auf den Äckern zur Regeneration eingesetzt wird. „Bei den aktuellen klimatischen Bedingungen kommt die Senf-Pflanze allerdings nicht so gut zurecht, da sie sehr flach wurzelt. Lange Regenperioden oder Trockenheit sind daher nicht so leicht zu kompensieren“. Die Bodengesundheit wirkt sich direkt auf die Pflanzengesundheit aus: Fehlen Pflanzen Nährstoffe und Spurenelemente in einem ausgewogenen Verhältnis, liefern sie zwar Ertrag, können aber darüber hinaus fast nichts leisten. Ernährungssysteme sollten so gestaltet werden, dass sie uns gesund und nachhaltig versorgen – und dabei auch die Landwirte am Anfang der Wertschöpfungskette fair einbinden.
Weiterführende Informationen:
Familie Bergmair wurde für die BR-Dokumentation „Süß oder Scharf“ – Kochgeschichten vom Senf von Matti Baur ein Jahr lang mit der Kamera begleitet
Warum Landwirtschaft und Ernährungssystem nachhaltig transformiert werden müssen
Warum Gesundheit nicht nur in uns, sondern auch im Boden beginnt
„Die Zukunft liegt in unseren Händen und in unseren Nahrungsmitteln“
Interdisziplinäre Medizin, Land + Innovation geht nicht? Geht doch!
Christine Bergmair: Zukunftssicheres Umsetzen von Entwicklung und Gesundheit im Kontext von SDG 11 am Beispielprojekt i-Tüpferl. + Alexandra Hildebrandt und Christine Bergmair: Klimaschutz und Soziale Orte im Kommunalen. Beide Beiträge in: Zukunft Stadt: Die globale und lokale Bedeutung von SDG 11. Wie die sozialökologische Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft gelingen kann. Handlungsempfehlungen – Chancen – Entwicklungen. Hg. von Alexandra Hildebrandt, Matthias Krieger und Peter Bachmann. SpringerGabler. Berlin, Heidelberg 2025.
Yvonne Zwick mit Miriam Holzapfel: Nachhaltigkeit machen. 17 radikale Thesen für echten Wandel. Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Freiburg 2025.