Dürfen Firmen ihre Angestellten überwachen, Frau Wildhaber?
Firmen wollen wissen, ob die Angestellten zu Hause arbeiten. Doch dürfen sie die Aktivitäten überprüfen? Die Arbeitsrechtsexpertin ordnet ein.
Wäsche waschen und Mittagessen kochen – das machen heute viele Angestellte neben der Arbeit im Homeoffice. Dabei stellen sie sicher, dass ihr Status in Chat-Programmen grün bleibt und so beim Arbeitgeber der Eindruck entsteht, dass sie am Arbeiten sind. Dieses Vortäuschen der Arbeit heisst «Fake Work» und ist Firmen zunehmend ein Dorn im Auge.
Während sie früher im Büro ein klares Indiz hatten, ob eine Person vor Ort und entsprechend am Arbeiten ist, können sie die Angestellten im Homeoffice nicht mehr beobachten. Nun gibt es Firmen wie Novartis, die mit «Arbeitsplatz-Analytics» messen, ob ihre Angestellten telefonieren, E-Mails schreiben oder in digitalen Meetings sind. Oder aber Privatdetekteien wie die Basilisk Detektei, die spezifische Angebote für die Überprüfung der Angestellten im Homeoffice anbieten.
Beide Varianten seien jedoch kritisch, sagt Arbeitsrechtsexpertin Isabelle Wildhaber von der Universität St. Gallen. Sie zeigt im Gespräch auf, inwiefern Überwachung im Homeoffice möglich ist und wo die Grenzen sind.
Frau Wildhaber, wie definieren Sie «Fake Work»?
Fake Work wird teilweise definiert als Arbeit, bei der die Ausführenden zwar beschäftigt sind, die aber weder ihnen selbst noch dem Unternehmen einen messbaren Mehrwert liefert, also beispielsweise Meetings ohne klare Zielsetzung.
Meetings ohne klare Zielsetzung sind jedoch nicht zwingend ein Fake-Work-Problem, sondern zeugen von ineffizienter Führung?
Klar. Das ist für mich eine Frage der Führung und der Selbstorganisation im Unternehmen. Fällt diese Art von Fake Work an, dann gilt es sie zu verbessern. Es ist keine Frage der Arbeitszeit – auch ineffizient erbrachte Stunden, während der sich Arbeitnehmende zur Verfügung der Arbeitgeberin halten, ist Arbeitszeit. Überflüssige Aufgaben, die Ressourcen binden, sind von der Arbeitgeberin zu verantworten und nicht das Problem der Arbeitnehmenden.
Sichern Sie sich jetzt das Digital-Abo für die Handelszeitung zum exklusiven Vorteilspreis!
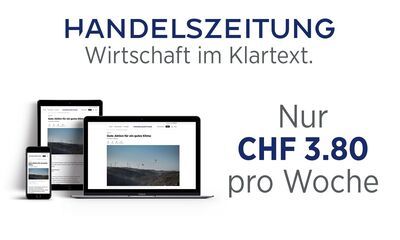
Hingegen verantworten die Angestellten es, wenn sie ihre Arbeit vorgaukeln. Sprich, sie schauen, dass ihr Status auf Grün ist im Chat, oder planen E-Mails ein, damit Vorgesetzte denken, sie arbeiten.
Genau. Unter Fake Work kann man auch verstehen, dass Arbeitnehmende im Homeoffice bei der Arbeitgeberin eingeloggt sind, sich aber mit etwas Privatem beschäftigen, wie Wäsche falten oder kochen.
Jetzt falten die Leute die Wäsche, früher plauderten sie dafür länger bei der Kaffeemaschine…
Schon immer gab es im analogen Arbeitsleben Arbeitnehmende, die zu viel Zeit privat am Telefon oder in der Kaffeeküche verbracht haben. Ausserhalb des Büros und mit den heutigen technischen Möglichkeiten scheint es aber einfacher zu sein, Arbeit vorzutäuschen und sich mit Arbeitsfremdem zu beschäftigen.
Was also gilt grundsätzlich?
Arbeitnehmende müssen grundsätzlich anwesend sein und innert nützlicher Frist reagieren können. Ist dies nicht der Fall, ist der Arbeitgeberin zu empfehlen, mehrere schriftliche Verwarnungen auszusprechen. Das kann dann zur ordentlichen oder gar fristlosen Kündigung der Arbeitnehmenden führen.
Und wie überprüfen Firmen, ob ihre Angestellten auch wirklich die Leistung erbringen?
Bei Arbeitgeberinnen kommt die Idee auf, Mitarbeitende mittels Spyware, Überwachungssoftware, auszuspionieren oder gar ein Detektivbüro anzuheuern.
Ist so etwas hierzulande erlaubt?
Bei der Überwachung gilt es aufzupassen, dass man nicht über die Stränge schlägt. Denn es handelt sich bei den betreffenden Arbeitnehmenden, die nicht richtig arbeiten, oft um Einzelfälle und man befindet sich schnell im illegalen Bereich. Überwachungsmassnahmen müssen dem schweizerischen Arbeits- und Datenschutzrecht genügen: Für Überwachungs- und Kontrollsysteme gilt, dass sie nicht vorwiegend zur Verhaltenskontrolle eingesetzt werden dürfen. Selbst eine vermeintlich beiläufige Verhaltenskontrolle muss ausserdem verhältnismässig sein. Zudem müssen die Arbeitnehmenden im Vorhinein über die Überwachung informiert worden sein. Das bedeutet, dass eine Arbeitgeberin elektronische Daten nur überwachen darf, wenn sie vorgängig über die Möglichkeit, die Art und das Ausmass der Überwachung informiert hat.
Gibt es Ausnahmen?
Überwachungs- und Kontrollmassnahmen können aus anderen Gründen erforderlich sein, wenn es beispielsweise um die Sicherheit geht. Eine Videoüberwachung im Kassenbereich z.B. dient der Verbrechensprävention und -bekämpfung.
Und wie verhält es sich konkret mit der Überwachung von Angestellten im Homeoffice?
Es wäre vertretbar, wenn über Slack oder Microsoft Teams Abwesende mittels der Statusanzeige registriert werden. Es wäre aber unzulässig, bei Arbeitnehmenden permanent eine PC-Kamera, einen GPS-Tracker oder einen Keylogger – ein Gerät, das die Tastatureingaben aufzeichnet – zu aktivieren. Das Bundesgericht hat den Einsatz einer Software, die ohne das Wissen der Arbeitnehmenden über Wochen die besuchten Websites aufzeichnete, als unzulässig erachtet. Anders ist es im Falle eines Verdacht auf eine Straftat. Bei Gerüchten über Straftaten darf die Arbeitgeberin mittels einer gewissenhaften internen Untersuchung ermitteln – das ergibt sich aus der Fürsorgepflicht der Arbeitgeberin. Die Arbeitgeberin kann die Untersuchung auch einem unabhängigen Dritten übergeben.
Abschliessend, was ist Ihre Zusammenfassung?
Alles in allem würde ich jedem Unternehmen empfehlen, mit Vertrauen und nicht mit Überwachung zu agieren, zumal bei Arbeitnehmenden mit zunehmender Überwachung das Bedürfnis steigt, das System und seine Kontrollen zu umgehen. Überwachungssysteme werden schnell «ausgetrickst».
Unsere Abos finden Sie hier: https://fal.cn/Xing_HZ_Abo
Mit dem Digital-Abo von Handelszeitung und BILANZ werden Sie umfassend und kompetent über alle relevanten Aspekte der Schweizer Wirtschaft informiert
Weitere News aus Wirtschaft, Politik und Finanzen finden Sie hier: https://fal.cn/Xing_HZ_Home

