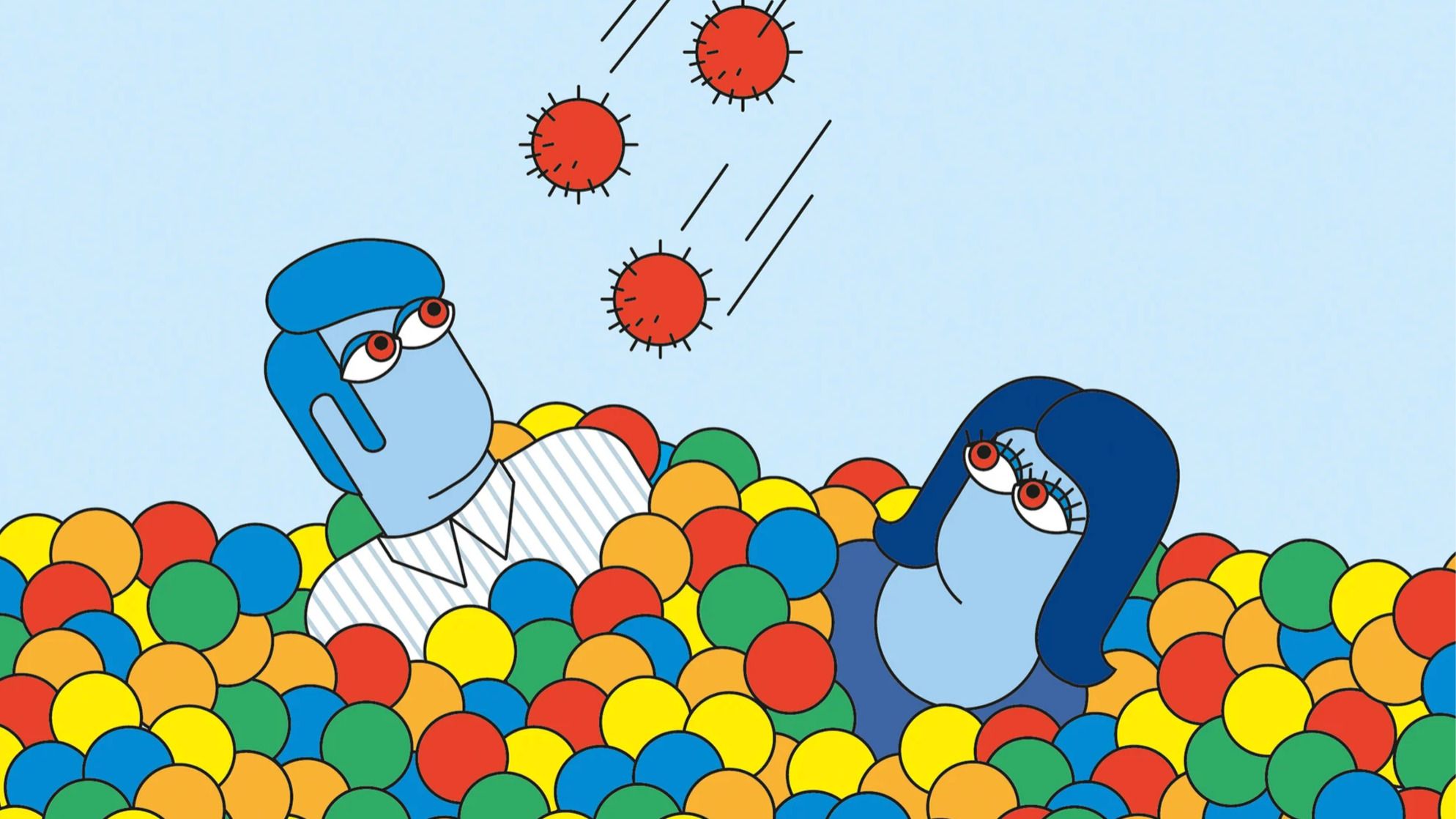Erfordert die Krise mehr Härte?
In der Krise wird der Ruf nach gnadenlosen Chefs immer lauter. Doch Strenge allein löst keine Not.
Knallhart? Nein, das sei er nicht, sagt Arno Haselhorst über sich selbst. Als konsequent beschreibt er seinen Führungsstil. Haselhorst ist Sanierer, jemand für schwierige Entscheidungen. Firmen, denen die Pleite droht, beauftragen ihn. Für einige Zeit übernimmt er einen Posten im Management – und krempelt das Unternehmen um.
Wer mit Haselhorst spricht, merkt schnell, dass er beides kann: harte Hand und Empathie. Auf welches Niveau muss ich die Personalkosten drücken, um konkurrenzfähig zu sein – und was bedeutet das in Stellen? Für ihn ist das eine simple Rechnung. Bei einer Firma entließ Haselhorst binnen fünf Monaten knapp 300 Mitarbeiter. Eine „unangenehme“ Aufgabe, sicher. Aber nur eine von vielen als Sanierer. „Die Unternehmen sind meist hoch verschuldet“, sagt er. „Wenn ich nicht vom ersten Tag an durchgreife, existieren sie schon bald nicht mehr.“ Das ist Haselhorsts eine Seite, die harte Hand.
Aber da ist eben auch noch die andere: Selbst wenn er manchmal nur einige Monate im Unternehmen ist, nimmt er sich viel Zeit, Vertrauen zur Belegschaft aufzubauen. Mit jeder Abteilung macht er eine Runde, in der die Mitarbeiter alles über ihn erfahren können: Wie viele Kinder haben Sie? Was war die größte Herausforderung Ihrer Karriere? Am Ende stehe fast immer das gleiche Fazit: „Sie sind ja gar nicht so unbarmherzig.“ Mit einigen ehemaligen Kollegen verbinden Haselhorst bis heute Freundschaften.
Ich will Ergebnisse sehen!
Konsequent und nahbar. Furchtlos und bedacht. Managementfähigkeiten, die sich vermeintlich ausschließen, braucht es in der aktuellen Krise besonders. Die Exporte sind zuletzt so stark zurückgegangen wie seit fast einem Jahr nicht, Unternehmen schrauben Investitionspläne drastisch herunter. Der Druck auf die Manager ist enorm. Und die greifen durch: Richard Lutz etwa. Der Bahn-Chef forderte von seinen Führungskräften, sie sollen „radikaler“ agieren. Einmal im Monat müssen sie nun berichten, wie die Sanierung in ihrem Bereich voranschreitet. Die Maßgabe von oben: „Nur Ergebnisse zählen.“
„Viele Führungskräfte pflegen in der Krise einen härteren Führungsstil als sonst“, weiß Peter Harms, der an der Universität von Alabama zur Persönlichkeit von Managern und autokratischer Führung forscht. Das sei „ihre Art und Weise, mit all dem Stress und Druck umzugehen und sich zu fokussieren“. Studien von Harms und anderen Arbeitspsychologen zeigen: Gerade zu Beginn einer Krise performen autokratische Führungskräfte häufig besonders gut. Wenn die Not am größten ist. Weil sie notwendige Entscheidungen schneller treffen. Weil sie Aufgaben und Ziele besser im Blick haben – und weniger die Bedürfnisse der Mitarbeiter.
Flexibel bleiben
Allerdings löst Härte keine strukturellen Probleme. Es genügt nicht, Leute vor die Tür zu setzen, Kosten zu drücken, unprofitable Geschäftsbereiche abzustoßen – und auf bessere Zeiten zu hoffen. Es gilt, wichtige Leute zu halten, zu motivieren. Neue zu finden. Und ein Umfeld zu schaffen, in dem Ideen für das nächste profitable Geschäft gedeihen. Es darf und soll in den Chefetagen jetzt härter zugehen, ja. Aber mit Weitsicht. Und mit Rücksicht.
Forscher Peter Harms verweist auf die Schwächen von autokratischen Führungskräften. Eine der größten: „Sie tendieren dazu, an ihren Entscheidungen zu hängen, selbst wenn sie wissen, dass sie einen Fehler gemacht haben.“ So sehr fürchten sie einen Reputationsverlust, wenn sie sich umentscheiden. Doch gerade in einer Krise braucht es die Fähigkeit, sich selbst und seine Entscheidung zu prüfen. Weil sich die Lage jeden Tag ändert, neue Informationen hinzukommen.
Auch Arno Haselhorst gibt viel vor, ja. Etwa wo die Kosten wie stark sinken sollen. Geht es ihm nicht schnell genug, hakt er nach. Und zwar häufig. Er könne dann sicher nerven, sagt Haselhorst. In einer Firma etwa machte er die Vorgabe, dass die Frachtkosten um 20 Prozent sinken müssen. Er erwarte nicht unbedingt, dass es wirklich 20 Prozent sind. „Aber“, betont er, „ich erwarte nachvollziehbare Gründe, warum das, was wir vorhaben, nicht funktioniert. Und dann müssen wir andere Maßnahmen entwickeln.“
👉 Exklusiv für Studierende: 12 Monate lesen, nur einen zahlen

Die Logistikabteilung allein konnte die Zielvorgabe gar nicht erreichen, denn die tatsächliche Ursache lag in der mangelnden Abstimmung zwischen Fertigung und Logistik: „Die Produkte waren am vereinbarten Übergabedatum nicht fertig, und die Mitarbeiter mussten kurzfristig teure Sondertransporte in Auftrag geben“, erzählt Haselhorst. Gemeinsam überarbeiteten sie die Lieferkette – und senkten so die Kosten. „Gerade sucht das Unternehmen noch einen großen Logistikpartner, der weltweit alles abwickeln soll“, erzählt Haselhorst. In der Krise braucht es eine engere Führung. Samt mehr Dialog. Mehr Abstimmung. Allerdings, so betont Roxana Boramir, Partnerin bei der Managementberatung Horváth, unter einer Bedingung: „Es darf nicht zu Mikromanagement kommen.“ Das demotiviere.
Was ist noch vertretbar? Und wo fängt Mikromanagement an? Für viele Vorgesetzte ist es ein Balanceakt. Sozialpsychologe Dieter Frey, der an der LMU München zu Führung forscht, sieht es als genuine Aufgabe von Chefinnen und Chefs an, Fortschritt zu überprüfen: Arbeiten wir schnell und effektiv genug? Ziehen alle Abteilungen mit? Und vor allem: Sind wir offen für neue Optionen? „Die Mitarbeiter an der Basis wissen am besten, was die Lösung ist. Sie kennen die Details“, sagt Frey. Chefs müssen einerseits „ein Höchstmaß an Freiräumen bieten“, aber klar vorgeben, welche Lösung umgesetzt wird. „Angst und Druck führen zu angepasstem Verhalten – und nicht zu kreativen Lösungen“, warnt der Psychologe.
Arno Haselhorst ist überzeugt, dass viele Führungskräfte nicht für die Krise gemacht sind. Er hat es schon erlebt, dass sich Teamleiter schützend vor ihre Mitarbeiter gestellt hätten – mit der Forderung: Kündigungen gibt es mit mir nicht. „In einer Notlage gefährdet eine solche Haltung das Unternehmen“, sagt der Sanierer. In den ersten Tagen eines Mandats spricht Haselhorst deshalb mit jeder Führungskraft auf den ersten zwei bis drei Hierarchiestufen – das sind in manchen Fällen schon mal 30 bis 40 Leute. Haselhorst stellt ihnen Fragen: Wie tragen Sie persönlich zum Firmenergebnis bei? Was haben Sie in Ihrem Bereich in den nächsten Jahren vor?
So will er herausfinden, wer hinter einer Transformation steht. Und von wem er sich womöglich trennen muss. „Wir tauschen zu Beginn einige Führungskräfte aus und besetzen manche Positionen mit Interimsmanagern, weil uns für mehr die Zeit fehlt“, erzählt Haselhorst. Auch Beraterin Roxana Boramir beobachtet derzeit, dass viele Unternehmen ihre Chefinnen und Chefs austauschen. „Sie müssen als Managerin und Manager bereit sein, sich von Führungskräften zu trennen, die einen Turnaround nicht mittragen.“
Nur nicht zu streng
Übertriebene Härte jedoch kann ebenso große Schäden verursachen wie ein zögerlicher Kurs: Vor drei Jahren, in der Coronakrise und vor allem kurz vor Weihnachten, entließ der Chef der Kreditplattform better.com 900 seiner Mitarbeiter – mit einem einzigen Zoom-Call. Es folgte ein Shitstorm. Und Arbeitspsychologe Harms muss nur eine Frage stellen, um diesen zu erklären: „Wer möchte für so jemanden arbeiten?“ Solche Aktionen zerstören Vertrauen. In der Belegschaft, aber auch darüber hinaus: bei Kunden, Partnern, möglichen neuen Mitarbeitern. „Und das kann man im Nachhinein kaum mehr reparieren“, betont die Beraterin Boramir. „Auch dann nicht, wenn es nach einer Krise wieder bergauf gehen sollte.“
Gleich zu Beginn eines Mandats gilt es für Arno Haselhorst, herauszufinden, welche Schlüsselpersonen er für eine erfolgreiche Transformation benötigt. Um sicherzustellen, dass diese das Unternehmen in der schwierigen Phase nicht verlassen, kann das Management auch schon mal Halteboni anbieten. Haselhorsts Erfahrung: Weitaus motivierender als ein paar 1000 Euro sei es für viele Mitarbeiter, wenn die Sanierung erfolgreich läuft, sich das Geschäft gut entwickelt. „Dann erkennen viele Beschäftigte: Es geht ja doch!“, sagt Haselhorst. Plötzlich haben sie eine Perspektive. Man spürt, dass Haselhorst das etwas bedeutet. Knallhart, das ist er eben nicht. Nur konsequent.
👉 Exklusiv für Studierende: 12 Monate lesen, nur einen zahlen