Fiesta vorbei, Focus verloren: Wie Ford Deutschland auseinanderbricht
Seit einem Jahrzehnt herrschen bei Ford Technikkrise, Richtungskrise, Führungskrise. Droht nun sogar der Abschied des Traditionskonzerns aus Deutschland?
Es ist noch gar nicht lange her, da zuckt für einen Augenblick bei Ford in Köln-Niehl die Hoffnung auf. Im Juni vor einem Jahr hauen Bundeskanzler Olaf Scholz und Henry Ford-Enkel William Clay in Schulterschluss auf einen roten Buzzer. Auf Bildern lachen sie inmitten einer Lichtershow und eröffnen das umgebaute Werk von Ford. Das wohl modernste Autowerk Europas, zwei Milliarden Euro teuer, gebaut nur für die E-Mobilität. Raus mit dem Fiesta, der hier seit 47 Jahren vom Band lief. Rein mit dem elektrischen SUV Explorer. Eine Zeitenwende für den Standort. Von einer „neuen Ära“, spricht Scholz. Von einem „neuen Atem für Ford“, spricht Clay.
Nur zwölf Monate sind seither vergangen – doch die Aufbruchstimmung ist verflogen. Seit Mitte November herrscht in Köln-Niehl Kurzarbeit. Erstmal bis zum Jahresende, wahrscheinlich auch danach, wie es vom Betriebsrat heißt. Wie die Branche, leidet Ford an der Elektroschwäche. Die Modelle verkaufen sich nicht, Ford verkauft sich nicht. Selbst die einstigen Kassenschlager Focus und Mondeo, die noch in Saarlouis, beziehungsweise Valencia gebaut werden, ziehen nicht mehr. Ford liegt bei den Absatzzahlen inzwischen hinter Nischenanbietern wie Kia zurück. Das an sich wäre im gegenwärtigen Autoblues nichts Ungewöhnliches. Aber die Abwärtsspirale bei Ford reicht tiefer.
Technikkrise, Richtungskrise, Führungskrise und das seit über einem Jahrzehnt. Der älteste ausländische Autobauer in Europa, einst stolzer Arbeitgeber von über 50.000 Beschäftigten nur in Deutschland, hat sich innerhalb weniger Jahre auf ein Fünftel geschrumpft.
Und kaum etwas spricht bislang dafür, dass das Unternehmen die Wende packt. Einen Europachef gibt es seit dem Sommer nicht, die Direktiven kommen neuerdings direkt aus Detroit. Der von dort verordnete Strategieschwenk in Richtung eines reinen Elektroanbieters erweist sich für Deutschland als Sackgasse. Das Unternehmen braucht dringend günstigere Angebote, um an das positive Image von Fiesta und Focus anzuknüpfen. Doch neue Modelle sind nicht in Sicht. Das Management in den USA hat derweil größere Probleme als Köln. „Ein Scherbenhaufen“, sagt einer, der das Unternehmen kürzlich verlassen hat. „Ein Abstieg auf Raten“, urteilt Autoexperte Stefan Bratzel. Das leise Ende einer Autogeschichte. Sollte Ford sich wirklich aus Europa zurückziehen, droht gar das Aus einer globalen Marke.
👉 Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen
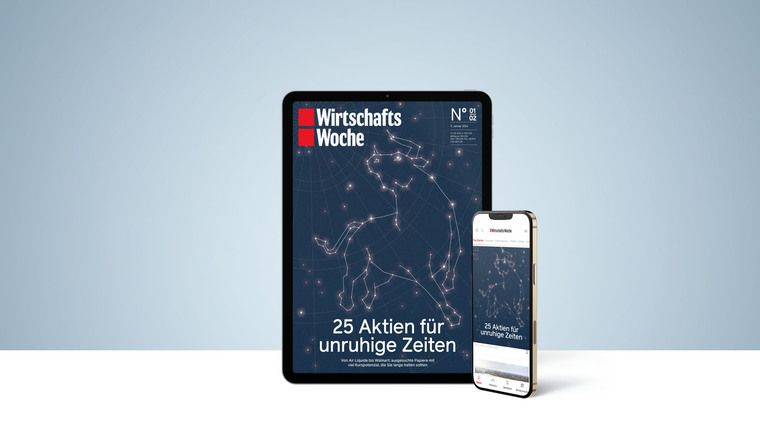
Wo hat sich Ford verzettelt?
Wo nur, mag man sich fragen, hat sich das Unternehmen verzettelt? Was ist bloß geworden aus diesem besonderen Riecher für die Wünsche der Kunden, der die Marke so lange ausgezeichnet hat? Jahrzehntelang zehrte man von einem Erfolgsrezept: schwere, mächtige Pickup-Trucks Typ F-150 für die Amerikaner. Leichte Kompaktwagen und aufgeblasene Familienkutschen für Europa.
Und dann folgt in den Nullerjahren der Abstieg. Die x-te Neuauflage der Kassenschlager zieht nicht mehr. Die Weiterentwicklungen werden weniger. Autoexperte Bratzel beobachtet schon länger die Entwicklung von Ford aus nächster Nähe. Vom Büro seines Autoinstituts in Bergisch-Gladbach braucht er nur eine knappe Stunde nach Köln. „Ford hat sich zu sehr auf seinen Lorbeeren ausgeruht“, findet er. Dabei habe das Management auf den sich verändernden Markt in Europa kaum reagiert. Mitte der Nullerjahre brachten die Südkoreaner ihre Kleinwagen mit Kampfpreis an die Leute, die Etablierten bauten zunehmend günstig in Osteuropa. Die Produktionskosten bei Ford Europa aber blieben mit Werken im Saarland, Belgien und England hoch.
Die darauf immerwährende Ansage aus den USA lautete: Werdet profitabel! Das ständig wechselnde Kölner Führungsteam – allein von 2013 bis 2019 gab es sechs verschiedene Europachefs – versuchte das mit einer Welle der Gesundschrumpfung zu erreichen. 2019 kam es zum Kahlschlag. Das Unternehmen schloss fünf Produktionsstätten in Europa, darunter eines in Frankreich und eines in Großbritannien. 12.000 Stellen fielen weg. „Die Europazentrale hat das Geschäft völlig falsch eingeschätzt“, tobte seinerzeit ein Betriebsrat in Saarlouis.
Ford betreibt seither zwar die effizientesten Fabriken, aber „die Marge für verkaufte Autos ist katastrophal“, erzählt ein Insider. Das Unternehmen hat Probleme, sich als globale Marke zu positionieren. Es kann kaum von einem weltweiten Produktionsnetzwerk profitieren, wie es die Deutschen lange Zeit nahezu perfektioniert hatten. Zu den Schwierigkeiten in Europa kommen die in China dazu. Um ein Fuß in die Tür zu kriegen, investiert Ford massiv in ein Joint Venture nach dem nächsten. Die Gewinne schwinden dennoch seit 2016 deutlich. Ein Kenner des Unternehmens erzählt davon, dass die vorher teuer ausgebildeten chinesischen Mitarbeiter reihenweise zur heimischen Konkurrenz überlaufen. Sowas spricht sich rum und schädigt die Marke. Die auch in Europa nötigen Milliarden – erstmal weg.
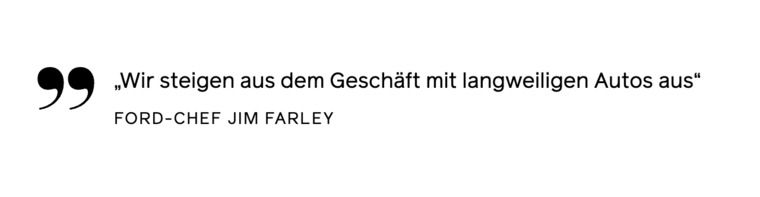
Chef Jim Farley, seit 2000 an der Macht, bläst inmitten der Coronapandemie zur radikalen Kursänderung: Weg vom Massenmarkt, hin zu Exklusivität und höherer Marge. „Wir steigen aus dem Geschäft mit langweiligen Autos aus und steigen in das Geschäft mit ikonischen Fahrzeugen ein“, verkündete der CEO erst vor Kurzem in einem britischen Fachjournal. Mit dem Mustang könne man es schließlich auch mit Porsche aufnehmen.
Kaum vorstellbar, dass in der Nische viele Werke nötig sein werden. In Saarlouis ist demnächst nach 54 Jahren Schluss. In Köln aber geht die neue Strategie auch mit der anfänglichen Ankündigung zu „E-Only“ bis 2030 einher. Kein Fiesta, sondern ausschließlich höherpreisige Elektrowagen, die es mit dem Golf und einem Einstiegs-BMW aufnehmen sollen. Und auf den ersten Blick ergibt die Idee durchaus Sinn: Für eine Neuentwicklung eines Kompaktwagens fehlt das Geld. Auch würde sich eine Produktion in den teuren westlichen Werken kaum lohnen, glaubt etwa Autoexperte Bratzel. Also macht das Unternehmen aus der Not eine Tugend: Für zwei Milliarden Euro wird Köln das Vorreiterwerk für die Elektromobilität von Ford.
Der Haken dabei: Das Unternehmen ist überhaupt noch nicht so weit, wie es gerne hätte. Im immerwährenden Sparzwang verpassen die Amerikaner, sich für die Zukunft zu rüsten. Weil die Technologie für ein Elektrofahrzeug fehlt, greift man kurzerhand zur Partnerschaft mit VW. Der Deal mit Wolfsburg wirkt selbst für Insider wie ein kruder Kuhhandel: VW bekommt die Partnerschaft beim beliebten Nutzfahrzeug Transit, der in der Türkei gefertigt wird. Ford hingegen darf bei den Leichtfahrzeugen für vermutlich viel Geld auf die Elektroplattform von VW zugreifen: den Elektromotor, die Batterie, die Elektronik, alles. Ein Volkswagen in Ford-Body, scherzt einer, der mit der Partnerschaft vertraut ist. Kaum möglich, mit einer VW-Kopie sich als Exklusivanbieter auf dem Markt zu profilieren, spotten Experten. Auch passe dazu bislang wenig das durch Fiesta und Focus geprägte Image eines Einsteigerfahrzeugs in Europa. „Es fehlt ein bezahlbares Elektroauto“, findet selbst der Kölner Betriebsratschef Benjamin Gruschka. Ob ein solches Modell mit der neuen Porsche-Strategie vorgesehen ist? Eher nicht.
„Europa in der Hierarchie ganz unten“
Überhaupt rechnet kaum einer mit einer schnellen Produktoffensive in Europa. Es scheint, als habe das Unternehmen genug mit dem Heimatmarkt zu tun. Ford konzentriert sich vor allem auf die Neuauflage der E-Trucks wie F-150 Lightning in den USA. Dort will man nicht den Anschluss an GM verlieren. Die Elektrostrategie erweist sich bislang als ein Hemmschuh. In den ersten neun Monaten machte das Unternehmen mit seinen Elektromodellen 3,7 Milliarden Dollar Verlust. Im Verhältnis zum Vorjahr sackte der Konzerngewinn jüngst um 24 Prozent auf knapp 900 Millionen Dollar ab. Auch deshalb rückte Chef Farley erst im Sommer von der „E-Only-Strategie“ ab. Man könne auch mit Benzinern und Hybrid gutes Geld verdienen, so die neue Ansage.
Dass die Technologiegelassenheit die Produkte in Köln nicht beschleunigt, ist klar. „Europa steht in der Hierarchie der Probleme ganz unten“, glaubt ein Ehemaliger. Zumindest will Ford schnell die Flotten mit eigener E-Plattform ins Rennen schicken. Weit weg von Detroit und nah bei den Techgiganten in Kalifornien entwickelt es seit geraumer Zeit die Batterien und Software für die nächste Generation auch für Europa. Mit größerer Zentralisierung der wichtigen Komponenten will Farley die Marge wieder in den Griff kriegen. Für die stolze Autoidentität in Deutschland kommt der Schritt einem Abstieg gleich. Noch vor Jahren lag die gesamte Entwicklung etwa eines Ford Fiestas auf den Schreibtischen der Kölner Belegschaft. Heute sollen die Verbliebenen „Einzelteile für ein Produkt aus den USA zuliefern“, wie es ein Insider ausdrückt. Das sauge die Motivation, berichtet er. Man dürfe sich heute Ford Europa nicht so autonom vorstellen wie Volkswagen, sagt Betriebsrat Gruschka. „Wir sind ein Satellit der Amerikaner.“
Hoffnungsvoll schielen die Arbeitnehmer in Köln deshalb auf das nächste Jahr. Dann, wenn die EU-Flottenwerte der Autobauer sinken müssen und die Hersteller ihre Preise für E-Autos verringern könnten. Die höheren Absatzzahlen wären das vorläufige Ende der Kurzarbeit. Vielleicht gebe es auch eine Autoförderung durch die neue Regierung, wünscht sich Betriebsrat Gruschka.
Und selbst dann würde es ganz schwer werden, glaubt Autoexperte Bratzel. „Ich sehe die Zukunft für Ford skeptisch“, sagt er. Mit einem schnellen Abgang des Unternehmens vom europäischen Markt rechnet er trotzdem nicht. Und wenn – dann wäre eine Rückkehr fast unmöglich: „Dann könnten die Amerikaner die globalen Ambitionen aufgeben.“ Das habe Ford von GM gelernt.
👉 Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen
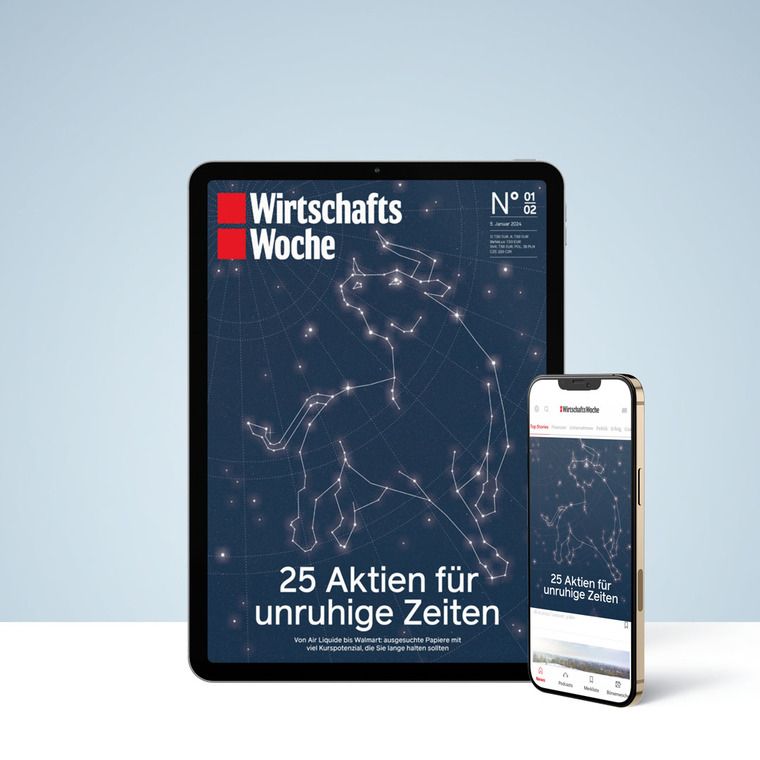
👉 Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen

