Geschwister als Co-Chefs: Die Königsklasse der Unternehmensführung
Immer mehr Familienunternehmen entscheiden sich für eine Doppelspitze aus Geschwistern. Tatsächlich kann diese ein Segen sein – trotz aller Risiken.
Als die Flut sie mitzureißen droht, finden Dörte und Meike Näkel Zuflucht auf einem Baum. Acht Stunden werden sie dort verbringen, bis ein Feuerwehrboot sie beim Morgengrauen retten kann. „Wir sahen unsere Weinfässer, unsere Maschinen vorbeischwimmen“, erinnert sich Meike. „Es war klar: Hier wird nichts mehr zu retten sein“, fügt Dörte hinzu.
Etwa zehn Meter hoch steigt die Ahr in jener Julinacht 2021, begräbt große Teile des rheinland-pfälzischen Dorfes Dernau unter sich – auch das direkt an der Ahr gelegene Produktions- und Lagergebäude des Weinguts, das die Näkels in dritter Generation betreiben.
Die beiden Schwestern haben in dieser schicksalhaften Nacht im Juli 2021 also allen Grund zu verzweifeln. Stattdessen aber reden sich die Co-Chefinnen gut zu: „Komm, reiß dich zusammen, das schaffen wir.“ Und sie erteilen sich gegenseitig, noch in der Baumkrone festsitzend, eine Mission: „Das ist unsere Chance, das Weingut gemeinsam wieder aufzubauen – und zwar ganz nach unseren eigenen Vorstellungen.“
Sobald sie wieder trockene Klamotten tragen, beginnt das Schlammschaufeln. „Man fühlte sich wie im Krieg – kein Wasser, kein Strom, alles kaputt“, beschreibt Meike die Wochen nach der Jahrhundertflut. Aber: „Jetzt erst recht, es muss weitergehen.“ Und so erweist sich die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal als eine Ausnahmesituation, die die beiden Schwestern noch enger zusammenschweißt. Und in der ihnen mehr denn je bewusst wird: „Wir ergänzen uns, sind froh, einander zu haben.“ Als Geschwister. Und als Co-Unternehmenschefinnen.
KONFLIKTE UNTERM BRENNGLAS
Die geschwisterliche Harmonie an der geteilten Unternehmensspitze ist beileibe nicht selbstverständlich. Im Gegenteil: Ein Familienunternehmen mit Geschwistern zu führen sei „die Königsklasse der Unternehmensführung“, schreibt die Managementforscherin Linda Lehner, die sich in einer wissenschaftlichen Untersuchung mit den Erfolgsfaktoren geschwisterlicher Führung beschäftigt hat. Geschwisterbeziehungen seien „eine reiche Mischung aus Liebe und Hass, Fürsorge und Missbrauch, Loyalität und Verrat“, befand der US-amerikanische Managementforscher Stewart Friedman schon in den 1990er-Jahren. Also: höchst zerbrechlich. Und: Die Zusammenarbeit als Doppelspitze potenziere diese geschwisterlichen Konfliktpotenziale „wie ein Brennglas“, attestiert Carola Jungwirth, die seit rund 20 Jahren Familienunternehmen bei Nachfolgefragen berät.
Kein Wunder also, dass die Geschichte der deutschen Wirtschaft voll ist von Schreckensgeschichten über brüder- und schwesterlichen Streit. Man denke nur an die Entstehung der beiden Marken, die zu den bekanntesten in Deutschland gehören: Adidas und Puma. Deren Gründung basiert auf einem erbitterten Streit zwischen zwei Brüdern, den Dasslers, die gemeinsam die Schuhfabrik ihres Vaters übernommen hatten. Oder an die Querelen der Bahlsen-Brüder, die 1999 die Aufspaltung des traditionsreichen Keks- und Chipsherstellers zur Folge hatten. Nicht nur die Erfahrungen aus diesen beiden Geschichten zeigen, dass sich geschwisterliche Konflikte häufig in der nächsten Generation fortsetzen, sich Familienstreits verfestigen, mit wirtschaftlichen und sozialen Folgen. „Die Risiken einer geschwisterlichen Doppelspitze sind immens – auch langfristig“, fasst Carola Jungwirth zusammen. Der Schritt dahin könne deshalb gar nicht gut genug überlegt sein.
AUSLAUFMODELL PATRIARCH
Und doch: Das Geschwisterduo sei inzwischen das „am weitesten verbreitete Co-Leadership-Konstrukt von Familienunternehmen“, attestiert Linda Lehner. Zuletzt war in 61 Prozent der Familienunternehmen mehr als ein Familienmitglied Miteigentümer des Unternehmens, wobei die Inhaber häufig auch als Geschäftsführer im Unternehmen tätig seien, wie aus Erhebungen des ifo Instituts hervorgeht.
Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen
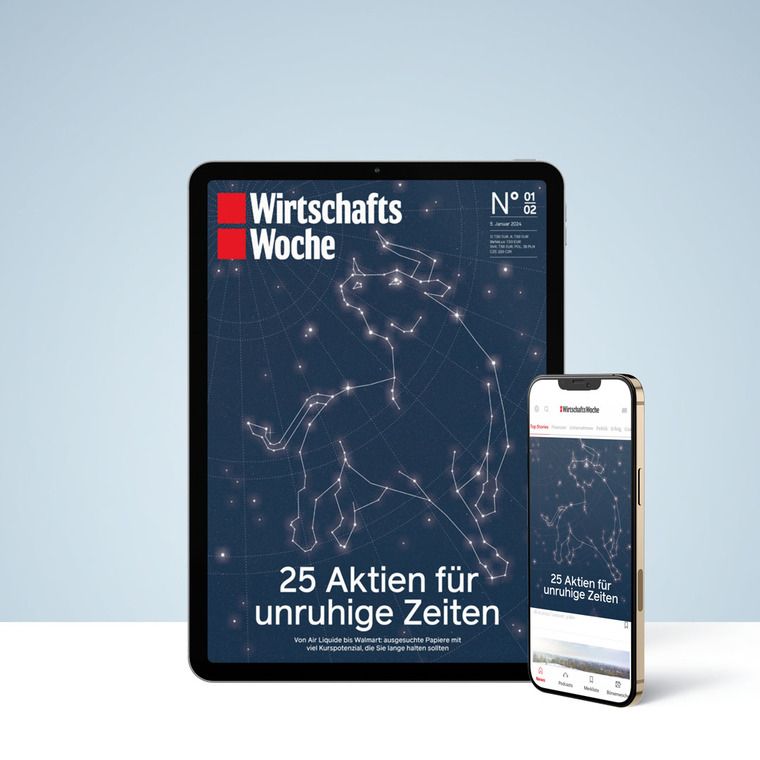
Es habe in den vergangenen 15 Jahren ein Kulturwandel im Management stattgefunden, sagt Carola Jungwirth – weg vom Patriarchalen, hin zum Kollaborativen. Das gelte generell in der Wirtschaft, aber besonders bei Familienunternehmen, von denen sich ein Gros gerade im Übergang in die dritte oder vierte Generation befinde. Und auch umgekehrt fänden Geschwister das Modell des gemeinsamen Führens inzwischen oft reizvoller als eine alleinige Übernahme des Betriebs, bemerkt Jungwirth: „Dass jemand sagt, er wolle es nur allein machen, erlebe ich eigentlich kaum mehr.“ Der aktuellste Beleg: Am 1. Februar haben Elisabeth Burda Furtwängler und Jacob Burda gemeinsam die unternehmerische und verlegerische Verantwortung des Medienkonzerns Hubert Burda Media übernommen.
Aber: Für wen taugt die geschwisterliche Doppelspitze wirklich zum Erfolgsmodell? Und wann überwiegen die Risiken? Kurz: Was unterscheidet nun die Näkel-Schwestern von den Dassler-Brüdern?
„Wenn man sich dafür entscheidet, das gemeinsam zu machen, dann darf es von da an nicht mehr um den Einzelnen gehen, sondern nur um das Gemeinsame, den Betrieb“, fasst Dörte Näkel ihr Erfolgsrezept zusammen. Und dafür wiederum sei es wichtig, dass zwischen den Geschwistern „ein neidfreies, konkurrenzfreies Verhältnis besteht“, betont die Expertin Carola Jungwirth. Klingt einfach, ist aber alles andere als selbstverständlich, wie auch Meike Näkel weiß: „Ich kenne viele Geschwisterpaare, bei denen es nicht funktioniert hat – weil die Charaktereigenschaften nicht zusammenpassten.“ Sie und ihre Schwester dagegen ergänzten sich einfach gut.
Denn Meike und Dörte Näkel sind sehr verschieden. „Wir haben unser ganzes Leben lang unterschiedliche Freundeskreise, unterschiedliche Interessen gehabt“, erzählt Dörte. Und auch im Charakter unterscheiden sie sich. Sie selbst sei eher jemand, der aus dem Bauch heraus entscheide, Schwester Meike jemand, der „alles überdenkt“, sagt Dörte. Vielleicht sei es gerade gut so, „dass man den Abstand und den Respekt davor hat, dass die andere eben anders ist“. Am Ende brauche es ohnehin meistens beides: das gute Bauchgefühl der einen und die kalkulierten Abwägungen der anderen.
Es geht also darum, sich gegenseitig in seinen jeweiligen Stärken und Schwächen zu akzeptieren und wertzuschätzen. Nicht zu vergleichen oder miteinander konkurrieren – wozu Geschwister häufig neigen. „Keiner kann alleine gewinnen“, schreiben die Nachfolgeberater Arno Lehmann-Tolkmitt und Nina Heinemann in einem Aufsatz über die Erfolgsfaktoren geschwisterlicher Führungstandems. Statt Ellbogen brauche es deshalb: „klare Rollen, basierend auf sich ergänzenden Fähigkeiten.“
So wie auch bei Lars und Lukas Meindl. Die beiden Brüder führen seit etwa 30 Jahren gemeinsam den Wanderschuhhersteller Meindl im oberbayrischen Kirchanschöring. Gänzlich geräuschlos: „Das mit uns beiden funktioniert einfach“, findet Lukas. Was wohl auch damit zu tun hat, dass die beiden sich in ihren Rollen im Unternehmen ergänzen und einander nicht in die Quere kommen: Lars, 56, verantwortet den kaufmännischen Bereich bei Meindl, Lukas, 59, Produktion und Entwicklung. „Ich war noch nie ein Zahlenmensch“, sagt dazu der ältere der beiden. „Mein Interesse galt nie dem Handwerklichen“, befindet der Jüngere: „Das hat sich eben von Anfang an gut ergänzt.“
Das Meindl-Modell sei „der Klassiker“, attestiert der Unternehmensberater Peter Baus: „Oft macht der eine die kaufmännische Geschäftsführung und der andere die technische.“ Baus entstammt selbst einem Familienunternehmen – und führt seit zehn Jahren ein privates Beratungsinstitut für Familienunternehmen, gemeinsam mit seiner Schwester. Er kennt die Fallstricke und Potenziale der geschwisterlichen Zusammenarbeit also auch aus eigener Erfahrung bestens. Und ist der Meinung: „Es gibt ein unheimliches Potenzial bei Geschwistern, die zusammenarbeiten und gemeinsam etwas bewegen wollen.“ Weil man unter Geschwistern eine „ganz andere Basis“ habe, sagt Baus. Er selbst etwa müsse sich mit seiner Schwester oft gar nicht absprechen, könne ihr als Co-Geschäftsführerin blind vertrauen: „Weil wir wissen, wie der andere tickt, und ein irres Vertrauensverhältnis zueinander haben.“
VORSORGE FÜR DEN NOTFALL
Aber man müsse dafür auch etwas tun: „Der häufigste Fehler besteht darin, sich einfach darauf zu verlassen, dass die Zusammenarbeit zwischen Geschwistern schon irgendwie klappen wird“, sagt Baus. Er rät stattdessen dazu, von vornherein „klare Richtlinien für eine langfristig angelegte Kooperation“ zu formulieren. Es gelte, die Rollen der einzelnen Chefs klar festzulegen; abzustecken, wie die Streitkultur aussieht, ob und wie Berufliches und Privates zu trennen sind. Wichtig sei zudem, von vornherein klar zu regeln: Was passiert, wenn es mit der Zusammenarbeit doch nicht klappt? Wer zahlt wen aus? „Diese Option ist in vielen Familienunternehmen gar nicht vorgesehen“, sagt Baus. Aber es sei wichtig, sich auch „auf die Ultima Ratio vorzubereiten“, um Konflikte zu vermeiden, die sich schlimmstenfalls über Generationen fortsetzen.
Diese Führungstypen gibt es in Unternehmen
**Traditionell absichernde Fürsorge:**Dieser Typ hat die Fähigkeit, Menschen im direkten Kontakt Sicherheit zu geben und ihnen persönlich den Rücken zu stärken. Der Chef ist authentisch, kompetent und besitzt natürliche Autorität. Loyalität und Zufriedenheit der Mitarbeitenden sind Ergebnis persönlicher Vorbildfunktion und Verantwortungsübernahme. Zentrales Ziel ist, langfristig die Arbeitsplätze der Menschen im Unternehmen und stabile Beziehungen und Organisationsverhältnisse zu sichern.
Steuern nach Zahlen: Die zahlengetriebene Führungskraft ist in der Lage, Menschen so zu organisieren, dass sie auf der Basis eines bestehenden Geschäftsmodells maximalen Profit erwirtschaften. Gute Führung erhöht die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens über Strategie, Zielemanagement und ein professionelles, auf Kennzahlen gestütztes Controlling. Zentrales Ziel ist, eine attraktive Rendite für die Kapitaleigner zu gewährleisten.
Kooperativer Teamarbeiter: Eine gute Führungskraft dieses Typs unterstützt und begleitet die Zusammenarbeit in dezentral organisierten, sich flexibel verschiedenen Aufgabenstellungen anpassenden Teams. Wenn der Manager gut ist, fördert er die Erhöhung der internen Diversität, sorgt für maximale Transparenz von Information und gemeinsame Reflexion von Zusammenhängen. Zentrales Ziel ist, Synergiepotenziale im und zwischen Unternehmen zu heben.
Netzwerk-Dynamiker: Dieser Chef lässt viel Raum für Eigeninitiative und begünstigt die ungehinderte, hierarchiefreie Vernetzung zwischen allen Akteuren im Unternehmen. Wenn er seinen Job gut macht, vereint er Menschen mit unterschiedlichen Lebensentwürfen unter einer attraktiven Vision und vertraut auf ihre Fähigkeit zur Selbstorganisation. Zentrales Ziel ist, die Komplexität vernetzter Märkte durch eigene Netzwerke zu bewältigen.
Stakeholder-Versteher: Eine gute Führungskraft dieses Typs motiviert hauptsächlich über persönliche Wertschätzung, Freiräume und die Sinnhaftigkeit gemeinsamer Arbeitszusammenhänge. Er ist offen für basisdemokratische Teilhabe. Themen gesellschaftlicher Solidarität und sozialer Verantwortung sind im Alltagshandeln präsent und wichtig. Zentrales Ziel ist, die Interessen aller relevanten Stakeholder optimal zu balancieren.
Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen
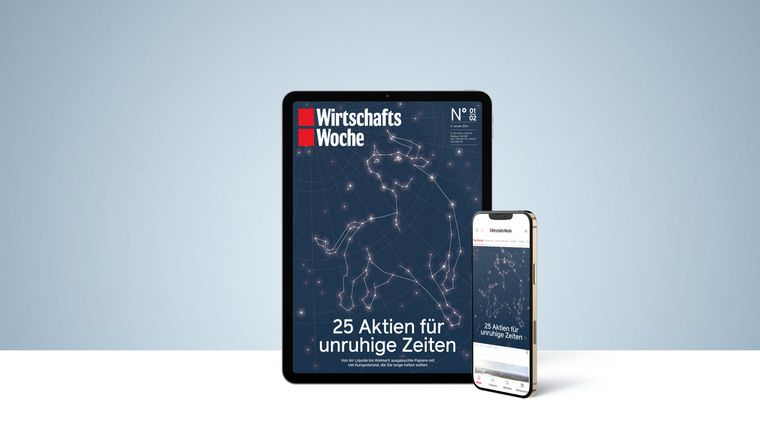
Ohnehin, betont Carola Jungwirth, gelte: Das „A und O“ für jedes geschwisterliche Führungsduo seien gemeinsame Ziele, gemeinsame Werte sowie funktionierende Abstimmungsprozesse. „Wenn ich mich zusammenraufe als Führungsduo, dann brauche ich eine gemeinsame Ausrichtung“, fasst sie zusammen.
Dabei braucht es nicht erst eine gemeinsame Nacht auf dem Baum inmitten einer Flut, nicht erst die Zwänge, ein Familienunternehmen aus Trümmern zu retten, um sich auf Gemeinsames zu besinnen. So wie bei den Näkel-Schwestern. Es geht auch ohne Katastrophe. Auch die Meindl-Brüder haben ein Ziel, das sie als Unternehmenschefs eint: „Das besteht darin, dass das Unternehmen funktioniert. Und zwar so, dass es auch eine gute Zukunft hat“, sagt Lars. Beide verstehen darunter: bloß nicht zu viele Experimente jenseits des erprobten Geschäfts mit den Wanderschuhen. Man wolle das Geschäft „nicht unnötig kompliziert machen“, die Risiken minimieren. Als Duo verstehen sie sich vor allem als Bewahrer einer Familientradition – und als Verwalter für die Generation, die folgt. „Wir haben das von unseren Eltern kennengelernt und übernommen“, erzählt Lukas. „Wir sind in einer Familie aufgewachsen, in der es nie um einzelne Personen ging, sondern immer um die Familie. Das hat immer gut funktioniert und wird bei uns genauso immer gut funktionieren.“
Werte und Ziele abzugleichen ist genauso wichtig wie die SteuererklärungPETER BAUS, BERATER FÜR UNTERNEHMERFAMILIEN
TRADITION ALLEIN REICHT NICHT
„,Wir sind doch eine Familie, es ist schon immer gut gegangen.‘ Solche Sätze höre ich immer wieder“, sagt Berater Peter Baus – und warnt davon, daraus eine Regel zu machen. Als Co-Unternehmenschefs begegneten sich Geschwister plötzlich in einer ganz neuen Rolle. Das sei nicht zu unterschätzen. Vor allem, weil die alte Rolle – die innerhalb der gemeinsamen Familie – ja bleibe. Viele Geschwister neigten dazu, kleineren Unstimmigkeiten im Job zu viel Relevanz beimessen, sie vielleicht sogar ins Private zu tragen. Was dann wiederum zu noch größeren Unstimmigkeiten im Betrieb führen kann.
Deswegen sollten sich Geschwister, so Baus’ Rat, auf die unternehmerischen Ziele verständigen und diese schriftlich festhalten. Auch in den Details: Wonach treffen wir Entscheidungen? Wie gehen wir mit Mitarbeitern um? Wo wollen wir das Unternehmen gemeinsam hinentwickeln? Welche Renditeerwartungen haben wir? Können wir uns auch neue Geschäftsfelder vorstellen?
All das von vornherein abzugleichen sei für Geschwister in der Doppelspitze „genauso wichtig wie die Steuererklärung“, zeigt sich Baus überzeugt. Er hat es auch schon erlebt, dass Geschwister dabei eben nicht zu einem gemeinsamen Leitfaden kamen. Und dann? In solchen Fällen rate er, sagt Baus, „sehr ernsthaft darüber zu sprechen, ob es überhaupt Sinn macht, sich zusammenzutun“.

