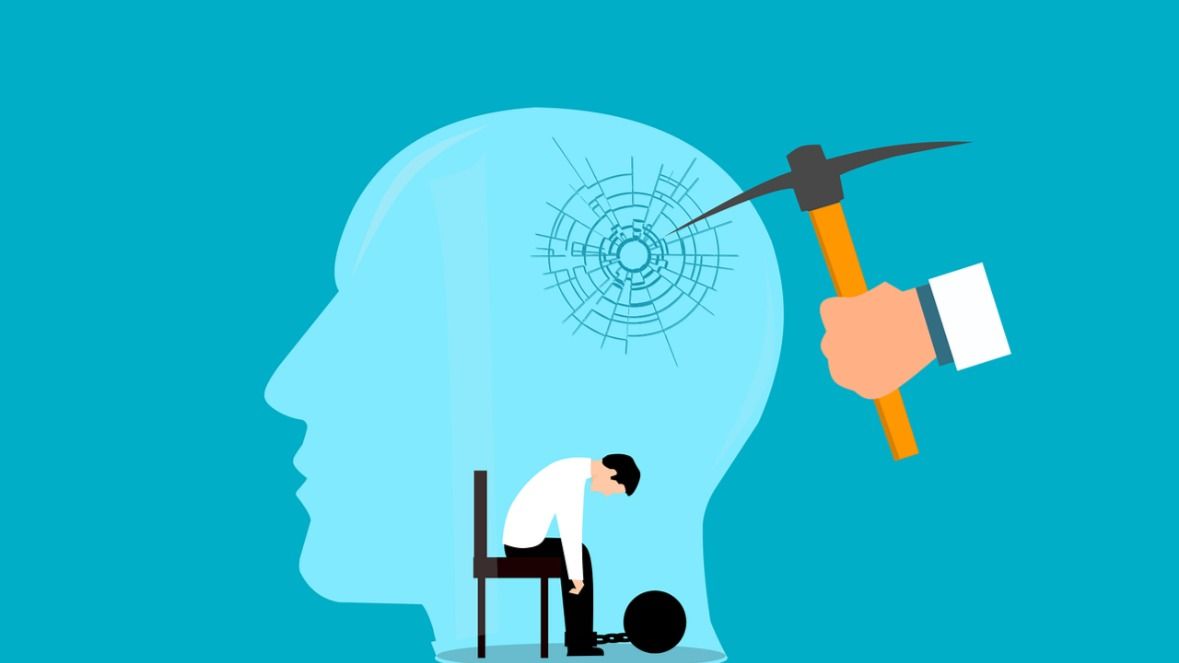Gesellschaft der Feigheit: Zum Versagen der inneren Moralinstanz
In einer Gesellschaft der Feiglinge geht der moralische Kompass schnell verloren. Warum ist das so? Die Gerichtspsychiaterin Heidi Kastner versucht in ihrem aktuellen Buch „Feigheit“ eine Diagnose und fordert wieder mehr Anstand und Sanktionen.
Feigheit als Versagen der inneren Moralinstanz
Derzeit erleben wir einen Wandel moralischen Forderungen und ein Scheitern davon. Der rüpelhafte Sprachgebrauch von heute hätte vor 30 Jahren noch zu sozialer Ächtung geführt. Heute regt sich kaum mehr jemand darüber auf. Hinzu kommen dumme Entscheidungen, die in der Geschichte der Menschheit "schon mehr Schaden angerichtet (hätten) als alle Waffen, Bakterien und Viren gemeinsam." Das schreibt Kastner in ihrem Vorgängerwerk über Dummheit. Die Auseinandersetzung damit ist notwendig, um den großen Kontext der Feigheit richtig zu verorten. Alles ist in den Publikationen miteinander verbunden. Heidi Kastner ist Psychiaterin, Primarärztin für forensische Psychiatrie und Gutachterin in Kriminalfällen. Am Neuromed Campus des Kepler Universitätsklinikums leitet sie die Abteilung für Forensische Psychiatrie. Mit Dummheit verbindet sie vor allem Ignoranz, Selbstsicherheit, Verantwortungslosigkeit und die unhinterfragbare Überzeugung, im Besitz der Wahrheit zu sein. Doch zum Wesen von Demokratie gehört es auch, auch, Ambiguität auszuhalten und zu akzeptieren, dass es nicht immer nur eine Meinung und eine richtige Lösung gibt. Unüberlegte Meinungsbildung ist häufig auch mit einem unkontrollierten Umgang mit Emotionen verbunden. Um in emotional nicht "überzulaufen", braucht es innere Stabilitätsanker, die dazu beitragen, sich zu sich selbst und der Welt ins Verhältnis zu setzen, um bestimmte Situationen besser zu meistern. Leider werden auch Fakten heute kaum mehr abgeglichen und eingeordnet – es geht oft nur noch darum, Recht zu haben. Derselbe Mechanismus funktioniert bei Verschwörungsmythen.
Faktenverweigerung hat heute Hochkonjunktur.
Auf einem solchen Boden gedeihen Systeme des Wegschauens, des Sich-Schönredens (z. B. von Übergriffen und Machtmissbrauch) - und der Feigheit. Sie ist in der Regel von Angst geprägt und bestimmt unser Tun. „Furcht“ ist die falsche Übersetzung des griechischen Wortes δειλία („deilia“). Konkret übersetzt müsste es „Feigheit“ heißen. Im „Brockhaus Konversationslexikon“ von 1894, aus dem auch heidi Kastner zitiert, findet sich diese Definition: „Feigheit ist ein habitueller Zustand des Gemüts, in welchem sich der Mensch vor Gefahren oder Schmerzen in dem Grad scheut, daß dadurch einesteils seine Freiheit und Thatkraft gelähmt, andernteils sein Gefühl für Ehre und Schande abgestumpft wird.“ In alten Kulturen wird der Feigling häufig als geächtete Randfigur der Gemeinschaft gesehen. Der Begriff „Memme“, lat. „mamma“ (Mutterbrust), verweist darauf, dass es sich um jemanden handelt, der sich im Leben nicht behaupten kann. Stellen diese Randfiguren heute die Mehrheit? „Ist die Feigheit also eine Art Pandemie?“, fragt Kastner und verweist darauf, dass dadurch auch die eigene Resilienz und Zivilcourage geschwächt werden. Dabei ist es wichtig, zu sagen: „Pass auf, das geht so nicht!“ https://www.kleinezeitung.at/lebensart/sonntag/19565006/wir-brauchen-mehr-soziale-aechtung – doch wenn wir Angst haben, uns die Finger zu verbrennen, verschieben sich nach Kastner die Grenzen des Sagbaren immer weiter und niemand steht mehr für seine moralischen Überzeugungen ein. Platon sagte, dass man bei Feigheit aus falscher Furcht nicht reagiere.
„Die Feigheit ist unauslöschlich; wer einmal mit diesem Makel behaftet ist, ist es für immer.“ Montaigne
Wer die Realität mit bestechender Klarheit wahrnimmt, ist auch in der Lage, Haltung zu zeigen und richtige Entscheidungen zu treffen, sich der Folgen ihrer Handlungen bewusst zu sein und Verantwortung zu übernehmen. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Hannah Arendt verwiesen. Hannah Arendt sieht unter Rückbezug auf Aristoteles das wesentliche Charakteristikum des Menschen in der Befähigung zum Handeln als Anfangen-Können. Politische Teilhabe, das Einbringen in die Welt, ist wie eine zweite Geburt, „in der wir die nackte Tatsache des Geborenseins bestätigen, gleichsam die Verantwortung dafür auf uns nehmen“. Der Begriff Verantwortung stammt aus dem Rechtswesen und wurde im Sinne von „be-antworten“ (der Angeklagten) verwendet. Verantworten bedeutete, „sich vor Gericht verteidigen“ (und vor Gott). So schreibt auch Paulus seinem Schützling Timotheus: „Lass nicht zu, dass die Angst und Furcht vor Menschen oder Dingen dein Handeln bestimmt.“ Angst vor Herausforderungen und Gottverlassenheit finden sich bereits in der Bibel in der Geschichte von der Sturmstillung (Markus 4 / Matthäus 8) und in den Abschiedsreden Jesu (Johannes 14-17), in denen er sich vor seinem Weg ans Kreuz von seinen Jüngern verabschiedet. Es sind die einzigen Stellen des Neuen Testaments, an denen das Wort „Feigheit“ vorkommt.
„Und er (Jesus) sprach zu ihnen (seinen Jüngern): Was seid ihr so feige? Habt ihr noch keinen Glauben?“ (Die Bibel, Markus 4,40)
„Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und sei nicht feige.“ (Die Bibel, Johannes 14,27)
Das Buch:
Heidi Kastner: Feigheit. Auf der Suche nach dem moralischen Kompass. ecoWing Verlag. Salzburg 2025.
Weiterführende Informationen:
Bauchgefühl im Management. Die Rolle der Intuition in Wirtschaft, Gesellschaft und Sport. Hg. von Alexandra Hildebrandt und Werner Neumüller. SpringerGabler Verlag 2021.
Visionäre von heute – Gestalter von morgen. Inspirationen und Impulse für Unternehmer. Hg. von Alexandra Hildebrandt und Werner Neumüller. Verlag SpringerGabler, Heidelberg, Berlin 2018.