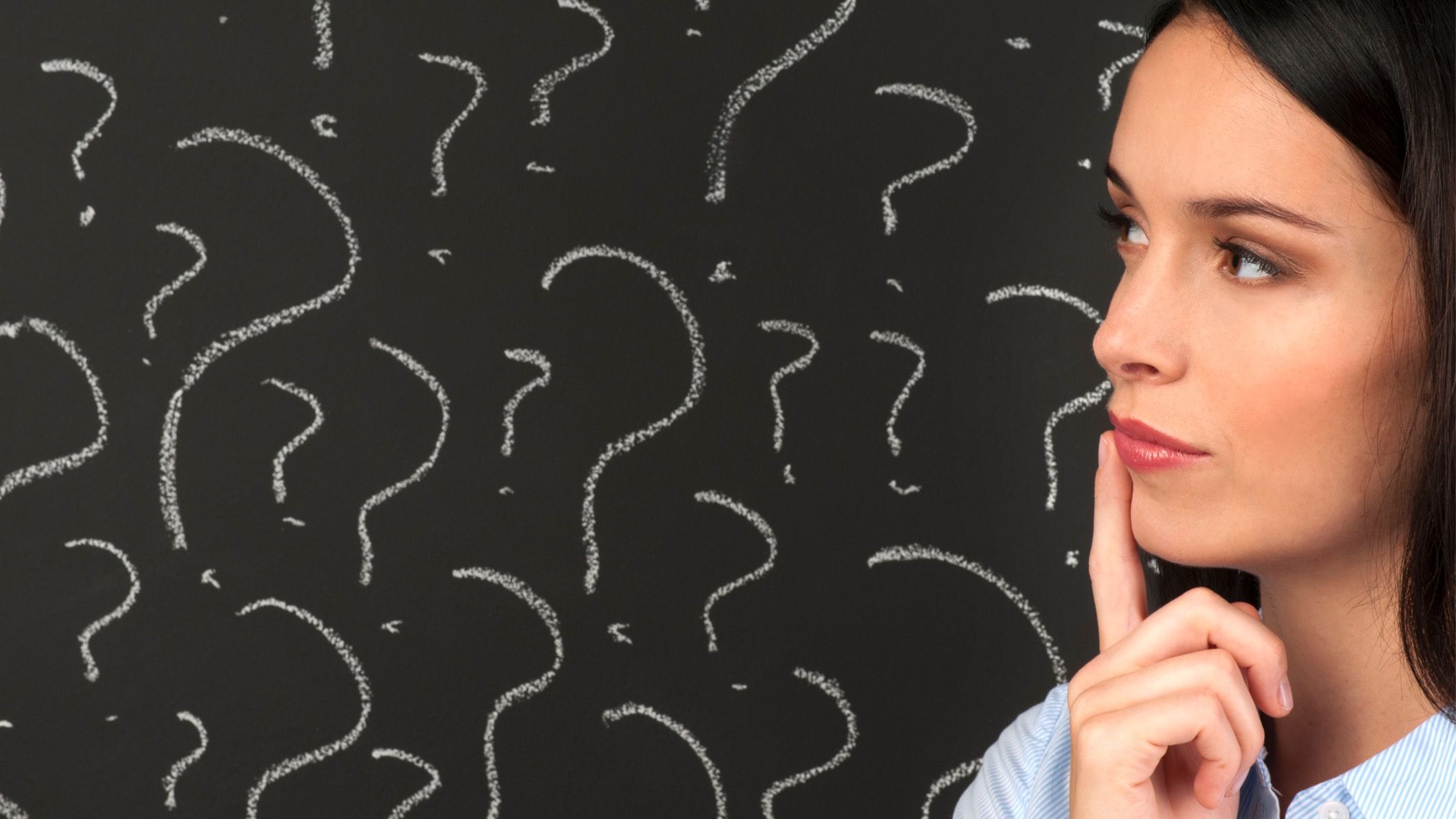Gute Führungskräfte wissen, wann es schlau ist, keine Entscheidungen zu treffen
Warum zielgerichtetes Nicht-Handeln ein Zeichen von strategischer Reife ist und wie man es gezielt einsetzt.
Die Welt dreht sich immer schneller. Überall poppen neue Technologien auf. Alle reden von mutigen Entscheidungen. Von Tempo. Von Klarheit. Von „einfach machen“. Wir sind gehetzt wie nie.
Machen ist halt wie Wollen, nur krasser. Oder? Aber gibt’s auch den umgekehrten Fall?
Was, wenn eine Entscheidung genau falsch ist?
Was, wenn nicht die Sofort-Reaktion, sondern die gezielte Verzögerung sinnvoll ist?
Wo und wie kommen „Entschleunigung“, „Achtsamkeit“ und langsames Denken in die Gleichung?
These
In einer komplexen Welt ist Entschleunigung kein Mangel an Führung, sondern ein Ausdruck strategischer Reife. Dazu ’ne kleine Story aus der Historienkiste über den Zauderer, der Rom rettete.
📜 Sommer 218 v. Chr.
Hannibal hatte mit Elefanten die Alpen bezwungen und zwei Legionen vernichtet. Panik brach aus. „Schlacht sofort!“, brüllte der römische Marktplatz. Der Senat rief einen Cäsar aus: Quintus Fabius Maximus Verrucosus. Die Stadt erwartete ein heroisches Gefecht – und erlebte stattdessen … nichts.
Fabius wartete. Er mied offene Kämpfe, folgte Hannibal und griff nur Versorgungszüge an – selbst dann noch, als Hannibal Felder abbrennen, Brunnen vergiften und Infrastruktur vernichten ließ. Senatoren spotteten, Offiziere murrten, das Volk verfluchte ihn. Doch Fabius blieb stoisch. Als Rom seine Geduld verlor und ohne ihn bei Cannae die „große Entscheidungsschlacht“ suchte, endete dies in der wohl vernichtendsten Niederlage der römischen Militärgeschichte. Gleichzeitig wurde klar, was Fabius’ scheinbare Untätigkeit erreichte: Er hielt Rom am Leben, bis die Republik wieder handlungsfähig war, und gab Scipio Zeit, eine Armee auszubilden, die den Krieg letztlich gewann. Heute wissen wir: Es war das „Zaudern“ von Fabius, das Rom rettete. Entschleunigung.
Warum Entschleunigung?
Entschleunigung ist kein Zufallsprodukt oder Schwäche. Es ist bewusstes Abwarten, gezieltes Ambiguität-Zulassen und manchmal: kalkuliertes Schweigen.
💭 Die Idee: In hochdynamischen, mehrdeutigen oder politisch aufgeladenen Situationen ist klare Positionierung nicht immer hilfreich – sondern kann Optionen zerstören, Konflikte eskalieren oder Entwicklungen vorschnell einfrieren.
Ist da auch wissenschaftlich Fleisch am Knochen?
Nicht-Entscheidung als Entscheidung: Entscheidungsprozesse in Organisationen sind lose gekoppelte, chaotische Systeme. Eine Entscheidung nicht zu treffen, kann bedeuten, alle Optionen offenzuhalten – was in Zeiten strategischer Unsicherheit Gold wert ist.🏅
Strategisches Schweigen: Schweigen in Organisationen ist nicht nur Angst – es kann strategisch sein. Gerade Führungskräfte setzen es ein, um Spannungen nicht zu früh zu adressieren oder die Energie im System zu halten.⚡
Paradoxe Führung: Erfolgreiche Führungskräfte können widersprüchliche Anforderungen gleichzeitig halten – zum Beispiel Innovation & Effizienz, Kontrolle & Vertrauen. Dazu gehört oft auch: ambivalente Aussagen stehen lassen.⚖️
Warum das funktioniert
Es verschafft Zeit. Nicht zum „Nichtstun“, sondern zum Beobachten. Lernen. Justieren.
Es lässt Verantwortung im System, statt sie zentral einzusammeln.
Es hält Spannung, wo vorschnelle Entladung zu falscher Richtung führt.
Es schützt fragile Allianzen, die bei Klartext zerbrechen würden.
⚠️ Aber Achtung! Entschleunigung funktioniert nur, wenn drei Bedingungen erfüllt sind:
Unentschieden ≠ unklar Du weißt genau, was du tust – und warum du nicht entscheidest.
Unentschieden ≠ egal Du beobachtest, analysierst, intervenierst subtil – aber steuernd.
Unentschieden ≠ unbeteiligt Du bleibst präsent, kommunizierst bewusst offen – und gibst Signale des Vertrauens.
Was du konkret tun kannst
Zielgerichtetes Nicht-Handeln kultivieren: Keine sofortigen Entscheidungen in Meetings, sondern Denkfenster einbauen („Lasst uns darüber einmal schlafen. Wir entscheiden das morgen“). Kommunikation von Nicht-Entscheidung als bewusster Akt („Wir lassen es reifen“).
Ambiguität explizit machen: Nicht vorgaukeln, dass alles klar sei. Stattdessen Unsicherheit als Führungsressource rahmen.
Entscheidungsreife erkennen statt Entscheidungstempo messen: Nicht „Wie schnell können wir entscheiden?“, sondern „Wie reif ist das Thema für eine Entscheidung?“.
Fazit
Entschleunigung ist kein Zeichen von Schwäche. Sie ist ein Zeichen von Reife, Systemkompetenz und Konflikttoleranz. Es ist die Fähigkeit, Entscheidungen zu verzögern, ohne die Verantwortung abzugeben.⏳
Gerade in komplexen Umfeldern ist die Fähigkeit, nicht sofort alles lösen zu wollen, ein Zeichen von starker Führung. Wer Spannung aushält, hält Potenziale offen. Manchmal ist Führung halt auch mal: nichts tun. Noch nicht. Nicht aus Angst. Sondern aus Klugheit.
Einig? Dann gern kommentieren, teilen oder folgen, wenn ihr was damit anfangen könnt. Herzlich willkommen! 🙌
Literatur
March, J. G., & Olsen, J. P. (1976). Organizational choice under ambiguity. Ambiguity and choice in organizations, 2, 10-23.
Milliken, F. J., Morrison, E. W., & Hewlin, P. F. (2003). An exploratory study of employee silence: Issues that employees don’t communicate upward and why. Journal of management studies, 40(6), 1453-1476.
Lewis, M. W., Andriopoulos, C., & Smith, W. K. (2014). Paradoxical leadership to enable strategic agility. California
Bildquelle: https://unsplash.com/de/fotos/eine-sanduhr-auf-einem-tisch-kb-ck1Y-KtY