Haier: Mit radikalem Führungsmodell zur globalen Haushaltsmarke
Mit einem radikalen Führungsmodell wurde der chinesische Haushaltsgerätehersteller Haier zu einer Weltmarke. Was steckt dahinter?
Kurz nachdem Zhang Ruimin die Führung des chinesischen Kühlschrankherstellers Haier 1984 übernommen hatte, gab er eine ungewöhnliche Anweisung: Die Mitarbeiter sollten, so die Legende, 76 Kühlschränke mit einem Vorschlaghammer zertrümmern.
Eine ziemlich konsequente Art, mit den Beschwerden von Kunden umzugehen. Oder genauer gesagt: ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen.
Diesen Grundsatz hat Ruimin bis zum Rücktritt 2021 tief im Konzern verankert. Und er dürfte ein Grund dafür sein, dass Haier heute einer der weltweit größten Hersteller von Haushaltsgeräten ist. Mehr als 120.000 Mitarbeiter, 48 Milliarden Euro Jahresumsatz.
Viele andere Firmen beschäftigen sich mehr mit sich selbst als mit dem nächsten großen Ding. Ruimin hat mit seinem Rendanheyi-Modell versucht, solch einer Entwicklung vorzubeugen.

Übernimm Verantwortung!
Rendanheyi bedeutet die Vereinigung von Mitarbeiter und dem Nutzen für Kunden: Die individuelle Leistung jedes Mitarbeiters von Haier soll so eng wie möglich mit dem verknüpft sein, was der Kunde davon hat. Aus Angestellten sollen Unternehmer werden – sowohl was ihre Entscheidungsfreiheit betrifft als auch ihre Verantwortung und ihre Bezahlung.
👉 Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen
Haier ist deshalb in mehr als 4000 Mikrounternehmen mit je 10 bis 20 Mitarbeitern unterteilt. Diese Einheiten agieren autonom – mit eigener Gewinn- und Verlustrechnung und viel Gestaltungsspielraum. Der Grundgedanke dabei: Menschen bringen sich erst dann richtig ein, wenn sie das Gefühl haben, etwas bewirken zu können – statt nur ein Rädchen in einer Organisation zu sein.
Die Mikrounternehmen setzen sich Ziele, die sie nicht an dem ausrichten, was sie im Vorjahr abgeliefert haben, wie in den meisten Unternehmen üblich, sondern an der Konkurrenz. Sie nehmen sich Markt für Markt, Produkt für Produkt vor und geben eine Wachstums- und Profitabilitätsprognose ab, die stets um ein Vielfaches über der jeweiligen Branche liegt.
Die Bezahlung jedes Mitarbeiters ist an die Ergebnisse seines Mikrounternehmens gekoppelt. Die Grundgehälter sind niedrig. Je stärker Teams ihre Ziele übertreffen, desto höher fallen Boni aus. Übertreffen sie die Ziele längerfristig, winken eine Dividende von 100 Prozent auf zuvor investiertes Kapital oder Gewinnbeteiligungen von mehr als 40 Prozent.
Wählt einen neuen Chef!
Jede Führungskraft kann vom Team abgewählt werden, wenn es nicht läuft. Hinkt ein Mikrounternehmen drei Monate hinter den ambitionierten Zielen hinterher, wird eine Neuwahl angesetzt. Jederzeit können sich Mitarbeiter aus anderen Teams für den Chefposten einer Einheit bewerben, wenn die bisherige Führungskraft nicht liefert.
Die Befürworter des Modells sehen darin einen Motor für Innovation, die Kritiker hingegen den Inbegriff des Raubtierkapitalismus: Mitarbeiter stehen unter enormem Leistungsdruck, finanzielle Sicherheit und soziale Absicherungen gibt es nicht.
In Deutschland dürfte das Modell in dieser radikalen Ausprägung allein aus arbeitsrechtlicher Sicht schwer umsetzbar sein.
👉 Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen
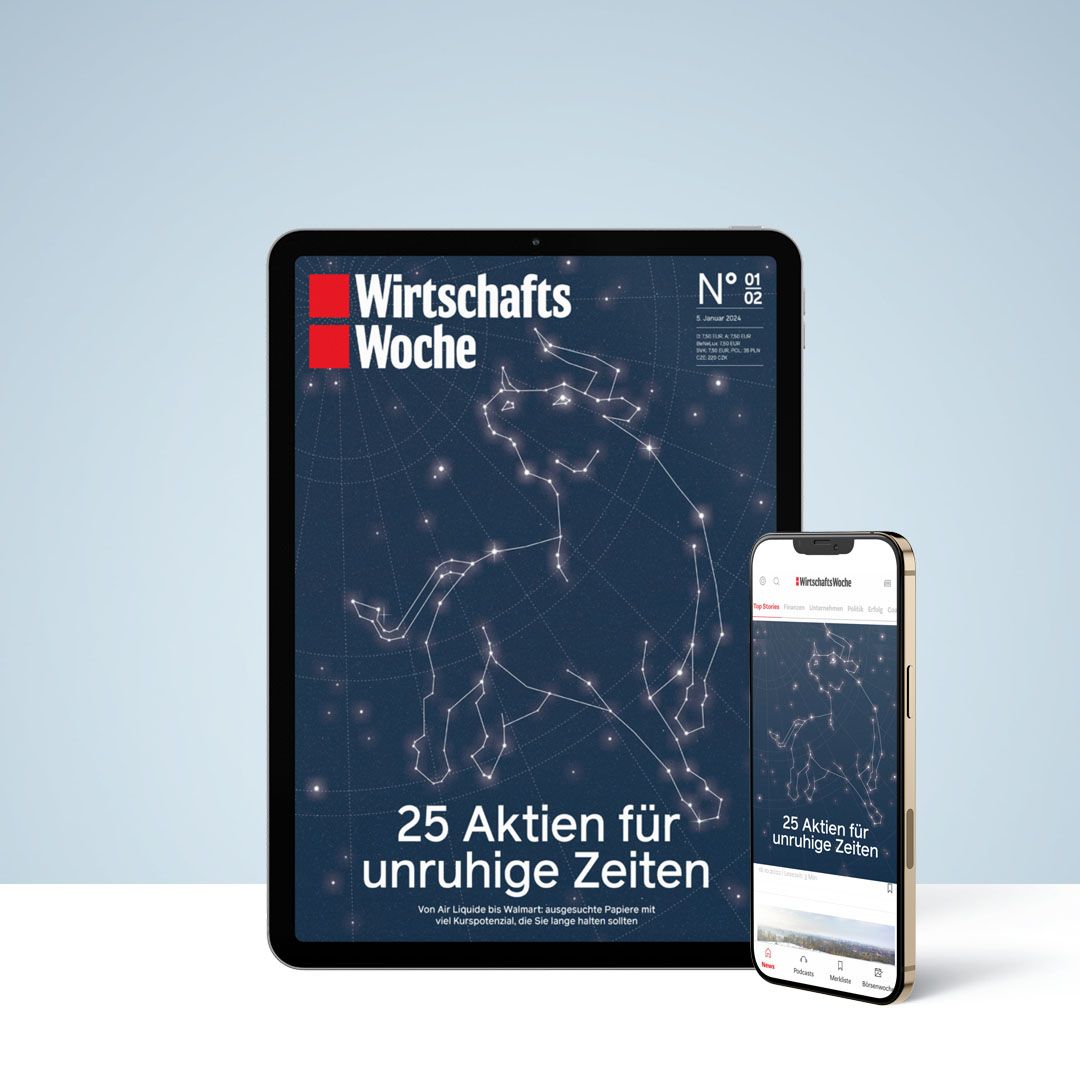
👉 Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen

