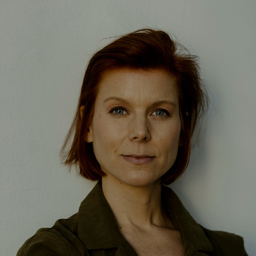Haushalt, Burn-out, Altersarmut – Wem bleibt da Geduld für schlechte Führung?
Frauen seien deutlich unzufriedener im Job als Männer, heißt es in der XING Wechselbereitschaftsstudie 2025. Könnte daran liegen, dass Frauen und weiblich gelesene Personen deutlich schlechtere Voraussetzungen vorfinden als Männer.
Im Auftrag der Jobplattform XING hat das Meinungsforschungsinstitut forsa Beschäftigte in Deutschland zu Themen wie Jobzufriedenheit oder Wünschen an künftige Arbeitgeber befragt. Doppelt so viele Frauen wie Männer denken demnach täglich über einen Jobwechsel nach, ihre Wechselbereitschaft sei allerdings nicht ausgeprägter als bei Männern.
Meine These: Weil für die meisten Frauen eben strukturelle und gesellschaftspolitische Begebenheit für die Unzufriedenheit sorgen. Und die folgen ihnen auch zum nächsten Arbeitsplatz. Ich habe drei der Schlüsselergebnisse kommentiert:
1. Leadership: Schlechte Führung spielt für Frauen eine deutlich wichtigere Rolle beim Jobwechsel als für Männer (43 Prozent vs. 30 Prozent)
Vielleicht sind Frauen und weibliche Führungskräfte sensibler gegenüber schlechter Führung – vielleicht haben sie höhere Ansprüche an Führung und Arbeitsklima –, aber ich denke nicht, dass das der springende Punkt ist. Ich glaube, sie geben sich einfach nicht damit zufrieden und sind weniger bereit, sich den Kämpfen, Auseinandersetzungen und zusätzlichen Belastungen auszusetzen, die mit schlechter Führung einhergehen.
Sie haben im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen zu viele Sonderbelastungen. Der Gender-Care-Gap liegt laut BMFSFJ derzeit bei 44,3 Prozent. Das bedeutet, dass Frauen fast doppelt so viel Zeit für die unbezahlte Betreuung und Pflege von Kindern, Kranken und Alten aufwenden wie ihre männlichen Kollegen.
Darüber hinaus tragen sie den Großteil dessen, was die Journalistin Jo Lücke „kognitive Care-Arbeit“ nennt – also die alltägliche, unsichtbare Verantwortung für die Organisation des Haushalts, der Termine und der Bedürfnisse aller Beteiligten, einschließlich des Partners. Darüber hinaus tragen Frauen* in der Regel den Emotional Load, das bedeutet, sie managen auch die Stimmung aller Familienmitglieder, sorgen für Zufriedenheit, beruhigen, lenken ab, ermutigen.
Am Arbeitsplatz selbst setzen sich diese Rollenbilder oft fort. So schlichtet die Kollegin in der Regel Konflikte, denkt an Geburtstage, übernimmt die Organisation des Boys/Girls-Days und der Weihnachtsfeier. Wenn man dann noch den ständigen Zeitdruck von Müttern, Unconscious Bias und zahlreiche strukturelle Hürden für Frauen*karrieren einkalkuliert – wer hat da noch Kraft für schlechte Führung?
Für mich nachvollziehbar: Jedes Mal, wenn ich ein Unternehmen verlassen habe, war es wegen der Führung. Nicht immer waren besagte Führungskräfte männlich, aber immer patriarchal veranlagt. Für mich ging dadurch Vertrauen und Sicherheit verloren. Und psychologische Sicherheit steht in direktem Zusammenhang mit besserer Lernbereitschaft, höherer Retention-Rate und gesteigerter Leistung.
2. Psychische Gesundheit: Für Frauen ist es deutlich wichtiger, ob sich der Arbeitgeber um ihr psychisches Wohlbefinden kümmert (37 Prozent Frauen vs. 23 Prozent Männer)
Psychische Gesundheit sollte ein elementarer Bestandteil von Gesundheit am Arbeitsplatz sein. Es ist ein einfacher Business-Case: Nur wer belastbar ist, ist auch leistungsfähig. Nur wer sich wohl fühlt, ist loyal. Ein Bewusstsein für psychische Gesundheit, ein offenes Ohr für die Bedürfnisse neurodivergenter Mitarbeitender und ein Umfeld, in dem Flexibilität auch bedeutet, Raum und Zeit für Therapiebesuche einzuräumen, gehören zu einem zukunftsfähigen Arbeitsplätzen.
Ich hatte das Glück, dass meine Arbeitgeber:innen meine Psychotherapie immer mit Flexibilität unterstützt haben. Das heißt, ich konnte längere Mittagspausen oder früher Feierabend machen oder später in den Tag starten. Das ist nicht selbstverständlich – sollte es aber sein. Nicht nur – wen wundert’s? – weil Frauen laut BKK Gesundheitsreport nachweislich häufiger von arbeitsbedingtem Stress und Burn-out betroffen sind.
Wie schön wäre es, wenn Arbeitgeber die psychische Gesundheit als festen Bestandteil in ihr Gesundheitsmanagement aufnehmen würden? Wie viele Angestellte könnten von kurzen Wegen zur psychologischer Unterstützung profitieren? Wie viele Unternehmen könnten sich vor langen, krankheitsbedingten Ausfällen schützen?
3. Altersarmut: Von allen Frauen, die angaben, über das Rentenalter hinaus zu arbeiten, sagten 63 Prozent, dass sie aus finanziellen Gründen dazu gezwungen seien
Eine aktuelle Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zeigt, dass mehr als jede zweite erwerbstätige Frau in Deutschland nicht genug verdient, um langfristig finanziell abgesichert zu sein. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: 53 Prozent aller erwerbstätigen Frauen können von ihrem Einkommen nicht leben!
Die Gründe dafür sind vielfältig: Etwa Erwerbsunterbrechungen wegen Kinderbetreuung und Pflege von Eltern und Schwiegereltern. Außerdem, natürlich, der Gender-Pay-Gap: Frauen verdienen immer noch 16 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen in gleichen Positionen.
Dazu kommt die Teilzeitfalle: 50,3 Prozent der Frauen arbeiten laut Statistischem Bundesamt (destatis) in Teilzeit, aber nur 13,4 Prozent der Männer. Teilzeitarbeit oder Erwerbsunterbrechungen führen bei vielen Frauen* und Müttern zu geringen Rentenansprüchen, in Vollzeit beschäftigte Väter und Partner übernehmen zu selten freiwillig die Rentenbeiträge ihrer Partnerin. Eine entsprechende gesetzliche Regelung lässt auf sich warten.
Männer dagegen profitieren ein Leben lang von der „patriarchalen Dividende“, ein Begriff, den die australische Soziologin Raewyn Connell geprägt hat. Er beschreibt, dass alle Männer, selbst die aus diskriminierten Gruppen, von der Vorherrschaft des Patriarchats profitieren. Natürlich haben auch Männer immer weniger lukrative Renten, die steigende Lebenserwartung und der Wunsch nach einem erfüllten und gesunden Leben im Alter tragen dazu bei. Aber – in Deutschland sind 20 Prozent aller Frauen über 65 von Altersarmut bedroht. Armut ist weiblich.
Die Umfrage untermalt das, was Gleichstellungsbeauftragte und -aktivist·innen seit Jahren anprangern – das System ist und bleibt fehlerhaft. Konstruktiver formuliert:
Wie viel Arbeitskraft, Innovation und Wirtschaftswachstum könnten wir in einem System erwirtschaften, indem Vereinbarkeit von Erwerbs- und Sorgearbeit zugunsten von Familien geregelt wäre?
Wie viele Kosten könnten eingespart werden, indem Arbeitgebende durch firmeninterne Initiativen oder aber durch entsprechende Sozialbeiträge in die mentale und physische Gesundheit ihrer Arbeitskräfte investierten und so auf eine gesunde, leistungsfähige und loyale Belegschaft zurückgreifen könnten?
Und wie viel Potenzial würde einer Gesellschaft eröffnet, in der Menschen aufgrund ihrer guten Altersvorsorge früh und in voller Gesundheit in Rente gehen könnten, um dann ihr wohlverdientes Geld auch zurück in den Wirtschaftskreislauf zu geben?
Welche konstruktiven Ideen hast du für eine inklusivere, gerechtere Arbeitswelt?