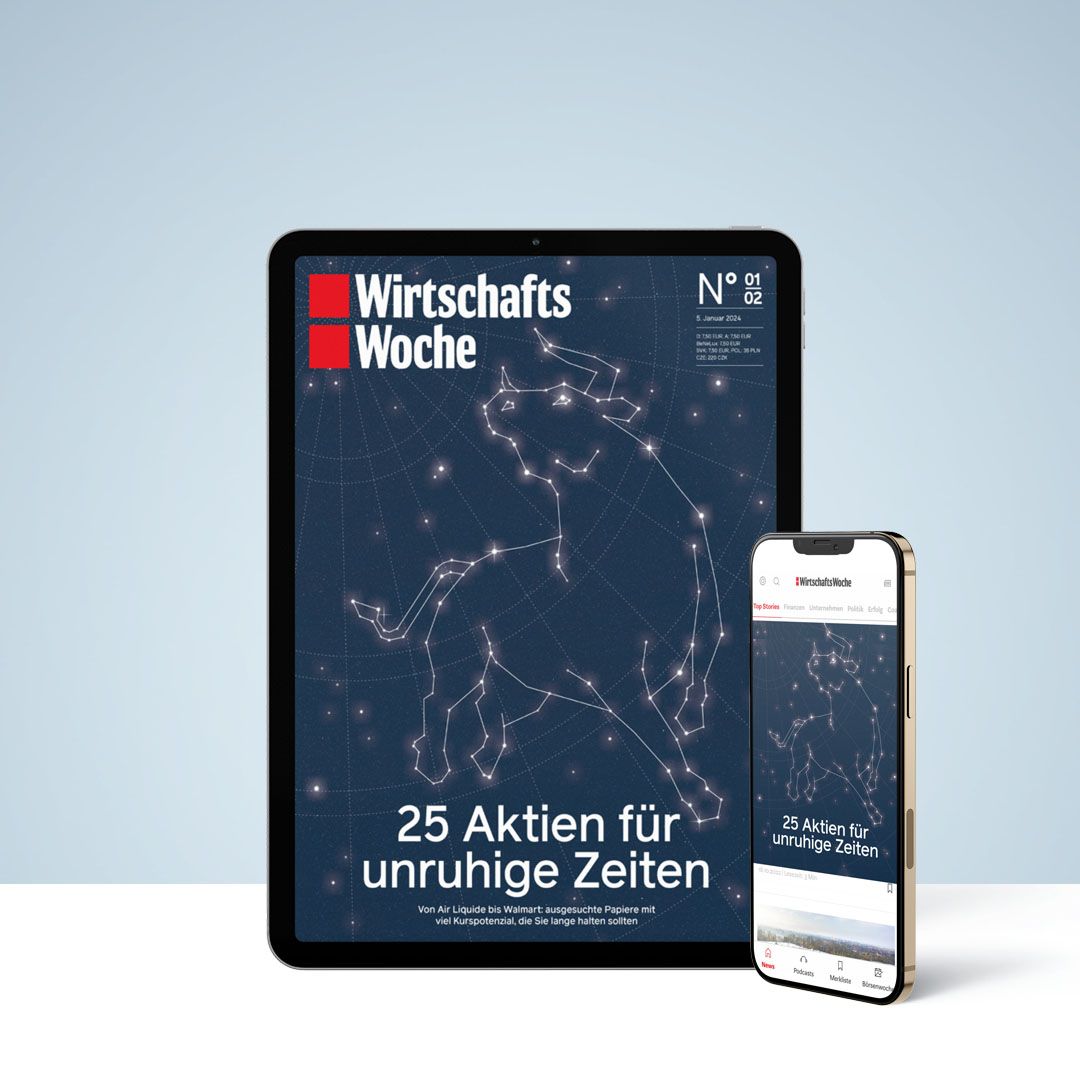Mal hart, mal weich: Wie Chefs der Wechsel gelingt
Chefs müssen unbequeme Entscheidungen treffen – und ihren Mitarbeitern trotzdem Freiräume bieten. Bei dem steten Wechsel gilt es, einiges zu beachten.
Thomas Olemotz rechnet bereits mit Gegenwind, als er die Mail an seine Mitarbeiter formuliert. Gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen beim IT-Dienstleister Bechtle stimmt er die Belegschaft im Februar 2024 auf eines der „herausforderndsten Jahre unserer jüngeren Unternehmensgeschichte“ ein – und macht klar: Der Arbeitsort sei grundsätzlich das Büro, einzelne Homeofficetage die Ausnahme. Mit einer „starken Präsenz“ soll die Produktivität steigen, um sich „wieder mit mehr Biss am Markt“ zu behaupten. So steht es in der Lokalpresse.
Solch harte Ansagen waren die 15 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht gewohnt. Auch weil es diese nicht brauchte. Das Geschäft lief über Jahre, beinahe Jahrzehnte. Seit dem Antritt von Olemotz als CEO 2010 ist der Aktienkurs zeitweise um 1500 Prozent gestiegen. Bechtle verdiente während der Pandemie gut daran, dass etliche Unternehmen Hals über Kopf neue Technik anschafften, damit ihre Mitarbeiter zu Hause arbeitsfähig waren. Und jetzt sollte ausgerechnet bei Bechtle das Homeoffice zur Ausnahme werden?
Der Konzern hat 120 Tochtergesellschaften in 14 Ländern. „Und die steuern wir mit sehr weitgehenden, dezentralen Freiheitsgraden“, betont Olemotz. Eine Ansage wie beim Homeoffice falle da auf. Tatsächlich murrte die Belegschaft. Aber: „Die Multikrisenlage“, sagt der Manager, „beschäftigt uns deutlich stärker als vorherige Krisen.“ Nach Jahren des Wachstums waren Umsatz und Gewinn 2024 gesunken. Da könne der Ton durchaus etwas bestimmter ausfallen, manche Entscheidung zentraler getroffen werden. Könne? Vielleicht muss es das sogar.
Dieser Wechsel ist gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wichtig. Studien von Arbeitspsychologen zeigen, dass Manager, die autokratisch führen, zu Beginn einer Krise besonders erfolgreich sind. Weil sie ein besseres Verständnis von der Notlage haben als die Belegschaft – und Entscheidungen schneller treffen. Und so überrascht es erst mal nicht, dass die Lufthansa offenbar plant, die Entscheidungsmacht der Firmenzentrale zu stärken: Sie soll künftig Angebot, Netz und Vertrieb der Fluggesellschaften steuern. Das Unternehmen konnte im vergangenen Jahr zwar Rekordumsätze erzielen. Allerdings: Der Konzerngewinn sank gegenüber dem Vorjahr um fast 18 Prozent.
DIE UNBELEHRBAREN AUTOKRATEN
Nur neigen autokratische Chefs dazu, an Entscheidungen selbst dann festzuhalten, wenn sie sich als falsch herausstellen. In einer Krise braucht es deshalb auch die Fähigkeit, den eigenen Kurs zu prüfen und Kritik anzunehmen. Erst hart, dann weich. Doch das Wechselspiel aus zentralen Entscheidungen und verteilter Verantwortung kann die Nerven strapazieren. Die der Chefs. Und die der Mitarbeiter.
Jacqueline Bauernfeind und Peter Diesch, Headhunter der Beratung Board Consultants International (BCI), beobachten bei vielen Chefs den Reflex, in einer angespannten Lage Entscheidungen an sich zu ziehen. Sie haben mit 42 Managern von Unternehmen mit Umsätzen bis zu 30 Milliarden Euro darüber gesprochen, wie sie mit akuten Krisen umgehen, darunter auch Thomas Olemotz. Die Führungskräfte setzten je nach Situation „sehr bewusst auf zentrale oder dezentrale Entscheidungen“, so die Berater. Am Morgen ordnen sie unter Zeitdruck ein neues Projekt an und verteilen Aufträge. Am Nachmittag ermutigen sie die Mitarbeiter, eigene Vorschläge anzubringen und moderieren ein ausgedehntes Brainstorming. Dieses Wechselspiel, sagen Bauernfeind und Diesch, sei „die Führung der Wahl“ in Krisenzeiten.
Schon der US-Psychologe Daniel Goleman schrieb im Jahr 2000, dass die effektivsten Chefinnen und Chefs „je nach Bedarf flexibel zwischen den Führungsstilen“ wechseln. Man müsse sich die Führungsstile wie die Schläger in der Tasche eines Golfprofis vorstellen. Den Driver für die langen Distanzen, den Wedge für das präzise Kurzspiel. „Der Profi spürt die bevorstehende Herausforderung, holt schnell das richtige Werkzeug hervor und setzt es elegant ein.“ Wie also werden Chefs zu Profis, die den Wechsel beherrschen? Wie bleiben sie dabei für die Belegschaft berechenbar? Wie sorgen sie dafür, dass ihre Leute bei dem Hin und Her mitmachen?
FESTE FORMATE HELFEN
Bei Bechtle sind die Zuständigkeiten der Geschäftsführer an den mehr als 100 Standorten und der Zentrale in Neckarsulm klar geregelt: Der Geschäftsführer entscheidet, welche Mitarbeiter mit welchem Profil er einstellt, wie viel er in Weiterbildung investiert, welche Kunden er mit welchen technologischen Lösungen anspricht. Die ganz großen Dinge, eine Übernahme etwa, liegen in der Verantwortung der Zentrale. „Aber: Vorschläge sind immer willkommen“, sagt Olemotz. Der CEO versteht die Geschäftsführer als „Unternehmer im Unternehmen – mit sehr hohen Freiheitsgraden.“ Und diese will er nicht „mit zu vielen zentralen Entscheidungen unterminieren“, wie er betont. Dabei helfen feste Regeln. Weil die Zentrale so der Versuchung widersteht, zu viel an sich zu reißen. Oder in den Kontrollwahn zu verfallen.
„Wenn Sie pro Jahr zweistellig wachsen und das Marktumfeld stabil ist, müssen Sie den Geschäftsführer nicht ständig anrufen und fragen, wie sein Projektbestand gerade aussieht“, sagt Olemotz. Da genüge es, einmal im Monat das Geschäft durchzusprechen: Wie hoch ist der Auftragsbestand? Mit welchen Umsätzen rechnet ihr im kommenden Quartal? Gerade aber ist der Markt alles andere als stabil. Und deshalb ist der Austausch derzeit intensiver, regelmäßiger. Zwei-, manchmal dreimal pro Monat finden diese „Geschäftsdurchsprachen“ derzeit statt, sagt Olemotz. „Um trittsicherer zu sein, wie die nächsten Monate ausfallen.“

Auch Simone Berger, seit 2019 Personalchefin beim Pharmakonzern Stada, seit 2021 zudem Teil des Vorstands, hat eine Formel gegen eine zu zentralistische Führung: Fünf bis sechs Prozent – größer sollte der Anteil der Mitarbeiter am Hauptsitz in Bad Vilbel nicht werden. Berger überprüft die Zahl regelmäßig und betont: „Das ist ein sehr guter Wert, unter dem Durchschnitt in unserer Industrie.“
Damit die Mitarbeiter den Wechsel zwischen den Führungsmodi nicht als unberechenbaren Zickzackkurs wahrnehmen, müssen Chefs ihr Vorgehen erklären. Und zwar rechtzeitig. Heike Bruch, Professorin für Leadership an der Universität St. Gallen, erinnert sich an einen Manager, der für eine eher enge Führung in seinem Team bekannt war, nun aber „beidhändig führen und seinem Team mehr Freiheiten und Zeit für Innovation bieten wollte, den Rücken freihalten“, wie Bruch es ausdrückt. Die Mitarbeiter signalisierten ihm schnell: „Wir brauchen nicht mehr Raum für Exploration. Uns stresst, nicht zu wissen, in welchem Modus du gerade bist.“ Wenn vom Chef der Auftrag kam: Erarbeitet mal ein Konzept für unseren Markteintritt in Indien, ging das Team stets davon aus, dass das ein umsetzungsreifer Plan sein sollte. Obwohl der Chef nur einen ersten Entwurf meinte.
VIEL VORWARNEN
Und so etablierte der CEO eine Gebrauchsanweisung für die Vorhaben. Erst in Treffen der Geschäftsleitung, später in jedem Meeting: Agendapunkte erhielten fortan die Markierung „Umsetzungsmodus“ oder „Explorationsmodus“. Der Vorteil laut Bruch: „So wissen alle, in welchem Modus sie gerade führen und arbeiten.“ Rückt die Deadline für ein wichtiges Projekt näher, spricht Simone Berger bei Stada zu Beginn eines Meetings klipp und klar an, dass sie den Ton angibt: „Wir haben jetzt zwei Stunden, morgen stellen wir das Projekt unseren Investoren vor. Eure Ideen sind immer super wertvoll und willkommen, aber heute zählt Fokus. Lasst uns loslegen mit dem ersten Punkt auf der Agenda.“ Berger sagt, sie habe die Erfahrung gemacht, dass die Klarheit bei den Mitarbeitern gut ankäme. „Weil alle dann genau wissen, woran sie sind.“
Auch Berater Diesch ist überzeugt, dass eine mal zentrale, mal dezentrale Führung „nur bei intensiver Kommunikation“ funktioniert: „Ich muss erklären, warum ich Spielräume temporär verenge oder erweitere. Sonst wirke ich willkürlich – und das zerstört das Vertrauen der Mitarbeiter, und sie ziehen nicht mit.“
Um der Belegschaft zu verdeutlichen, dass das Unternehmen auf Eigeninitiative setzt statt auf Ansagen von oben, gibt es bei Stada ein eigenes Programm: Stada+. Die Mitarbeiter sollen Geschäftsideen entwickeln und selbst umsetzen. Sie erstellen ein einseitiges Dokument „mit ihrer Idee, der Höhe des Investments oder prognostizierten Kosteneinsparungen“, erklärt Simone Berger. Sie präsentieren das Vorhaben – und dann wird entschieden. „Nur bei sehr hohen Investitionen ist unser CEO involviert.“ Eine Idee aus der jüngeren Vergangenheit ist der Personalchefin besonders im Kopf geblieben: Ein Mitarbeiter habe „eine kleine Verpackungsänderung“ bei den Grippostad-Medikamenten vorgeschlagen. Und die „spart uns jetzt jährlich 120 000 Euro, weil wir mit weniger Material auskommen“.
KLARE ANSAGEN, ERNSTE SORGEN
Stefan Kampmann musste in seiner Zeit bei Bosch mal hart durchgreifen. 2008 war das, er war Entwicklungsvorstand im Geschäftsbereich Automobilelektronik – und erhielt den Auftrag, mit vier anderen Divisionen in nur zwölf Monaten den Prototyp für ein E-Bike zu entwickeln. Mit Motor, Batterie und Steuerung. „Normalerweise waren für solche Entwicklungsprojekte 36 Monate vorgesehen“, erzählt Kampmann, der später bei Voith und Osram Technikvorstand war und heute im Aufsichtsrat von Zeiss sitzt. „Die Konkurrenz arbeitete auch daran, wir mussten schnell sein.“
Das größte Problem: die Konkurrenzdenke zwischen den Bereichen. Um die zu schleifen, trafen sich jeden Donnerstagabend in einer Telefonkonferenz die fünf Vorstände mit ihren Entwicklungsleitern. Die sollten sich jede Woche umhören, womit die Mitarbeiter gerade Schwierigkeiten hatten: Rückt eine Abteilung ein Patent nicht raus, das es für die Motoren braucht? Wie viele Kilometer müssen die Räder in Testverfahren absolvieren? In der Telefonkonferenz wurde dann entschieden. Ohne die Mitarbeiter. Aber über ihre Sorgen. „Wir wollten ihnen so zeigen, dass wir auf sie hören“, sagt Kampmann. „Das hat das gesamte Team enorm motiviert.“ Vermutlich ein entscheidender Erfolgsfaktor: Die Bosch-Technik steckt heute in E-Bikes von mehr als 100 Marken.
Auch Beraterin Jacqueline Bauernfeind weiß um die Bedeutung solcher Balanceakte zwischen zentraler und dezentraler Führung: Für sie liegt die Voraussetzung in einer „Kultur der Transparenz und des Vertrauens, in der sich die Mitarbeiter einbezogen und wertgeschätzt fühlen“. Dann, so ist Bauernfeind überzeugt, „können Sie auch unbequeme Entscheidungen treffen“. Ohne die Mitarbeiter gleich gegen sich aufzubringen.
WiWo-Premium Artikel
Was ist WiWo Premium bei XING News?
Innerhalb von XING News bietet WiWo Premium exklusive Inhalte der WirtschaftsWoche, die nur im Rahmen eines kostenpflichtigen Abos verfügbar sind.
Dabei handelt es sich um sorgfältig recherchierte Artikel – etwa fundierte Analysen, tiefgehende Interviews oder aktuelle Hintergrundberichte –, die regelmäßig auf der XING News-Seite veröffentlicht werden. Diese Inhalte sind im Newsletter klar als „WiWo Premium“ gekennzeichnet und führen zur entsprechenden Paywall auf XING News.
Ziel ist es, Leser:innen mit exklusiven Wirtschaftsthemen von hoher journalistischer Qualität zu versorgen – darunter Einblicke in Unternehmensstrategien, Entwicklungen an den Finanzmärkten oder relevante Marktanalysen – stets mit dem journalistischen Anspruch der WirtschaftsWoche.
Standard-Kampagne (dauerhaft gültig)
Gute und zuverlässige Orientierungshilfen sind in Zeiten wie diesen wichtiger denn je. Das Top-Redaktionsteam der WirtschaftWoche bietet genau das: Fundierte Analysen, erkenntnisreiche Hintergründe und intelligente Kommentare.
So bist Du stets bestens informiert – vom aktuellen Wirtschaftsgeschehen bis zu konkreten Geldanlagetipps. Jeden Freitag gibt's eine neue Ausgabe – und mit Premium bekommst Du 6 Ausgaben kostenlos zugeschickt, plus Zugang zur digitalen Version (z. B. in der App), zu allen Plus-Artikeln auf wiwo.de sowie zu spannenden Online-Events und zu hilfreichen Dossiers und Ratgebern.
Wenn Du auch danach stets auf dem Laufenden bleiben möchtest, musst Du nichts weiter tun und bekommst die WirtschaftsWoche (Print und digital) dann für 29,99 € / Monat. Ansonsten kündigst Du einfach 2 Wochen vor der letzten der 6 kostenlosen Ausgaben. Und auch danach bleibst Du flexibel und kannst jederzeit kündigen.* Wir wünschen Dir eine erkenntnisreiche Lektüre!
Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen