Produkte aus CO2: So wird der Klimasünder zum wertvollen Rohstoff
Grüne Technologien boomen. Immer mehr Firmen entwickeln Verfahren, um CO2 aufzufangen und wiederzuverwerten. Diese Ansätze haben besonderes Potenzial.
Seife aus Treibhausgasen, Bakterien, die CO2 fressen und daraus Lebensmittel produzieren, kohlenstoffneutraler Treibstoff – überall auf der Welt arbeiten Unternehmen und Wissenschaftler an Technologien, die dabei helfen, den CO2-Ausstoß zu reduzieren.
Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot

Das finnische Start-up Solar Foods filtert beispielsweise das Treibhausgas aus der Luft, verbindet es in einem mit Bakterien gefüllten Bioreaktor mit Stickstoff und Wasserstoff und fermentiert es anschließend mit Phosphor und Kalzium. Das daraus entstehende gelbe Pulver, Solein, besteht zum Großteil aus Proteinen und soll Fleischersatzprodukte oder verschiedene andere vegane Eiweißprodukte anreichern.
Das Verfahren nennt sich Carbon Capture and Utilization (CCU), also CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen und wiederzuverwerten, etwa als Grundlage für neue Produkte wie Treibstoff, Kleidung, Kosmetik und Lebensmittel.
Die Idee, die dahintersteckt: Gelingt es, klimaschädliches Kohlendioxid wiederzuverwerten, lässt sich das Klima auch dann schützen, auch wenn manche Co2-Emissionen nicht vermeidbar sind. Die Relevanz von CO2-Entnahme-Technologien im Kampf gegen den Klimawandel bestätigt auch der Weltklimarat (IPCC). Laut einem Bericht vom April 2022 sind sie „wahrscheinlich unabdingbar“, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen.
Neben der Einsparung und Reduzierung des CO2-Verbrauchs seien technologische Innovationen die letzte Rettung, um einen Wendepunkt beim Klimawandel zu erreichen. Das Potenzial dafür schätzen die Wissenschaftler als groß ein: Für dieses Jahrhundert ließen sich mit neuen Technologien bis zu 780 Milliarden Tonnen CO2 aus der Luft entfernen. Und die braucht es auch.
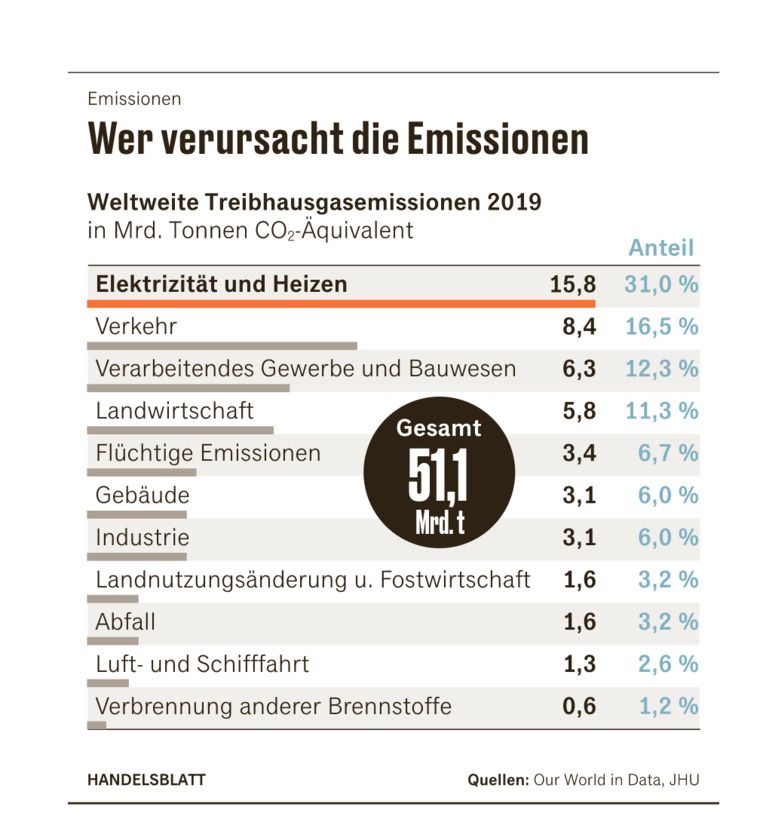
Bis zum Jahr 2050 erwarten Wissenschaftler des Global Carbon Project einen Anstieg der jährlichen CO2-Emissionen von heute 37 Milliarden Tonnen (2021) auf bis zu 43,1 Milliarden Tonnen weltweit. Dabei sieht das Pariser Klimaabkommen vor, die Emissionen bis 2050 auf null zu senken. Wissenschaft und Politik sind sich einig: Ohne neue Technologien lässt sich dieses Ziel nicht erreichen.
Genau dieses Potenzial haben auch Unternehmen erkannt. Der Markt für Abspaltung, Speicherung und Wiederverwertung von Kohlenstoff erreichte 2021 einen Wert von über zwei Milliarden Dollar und stieg seit 2016 jährlich um knapp fünf Prozent, zeigt ein Report des Marktforschungsinstituts „Research and Markets“. Laut der Prognose wird das Marktvolumen 2026 schätzungsweise bei 3,5 Milliarden US-Dollar liegen und sich bis zum Jahr 2031 fast verdoppeln. Große Unternehmen, Start-ups und Wissenschaftsinstitute arbeiten an verschiedenen CCU-Technologien.
Proteinpulver aus der Luft
Die weltweite Tierhaltung gehört mit rund 20 Prozent der Treibhausgasemissionen zu den Ursachen für die globale Erwärmung. Neben der Futtererzeugung ist vor allem das aus dem Magen von Rindern freigesetzte Methan Quelle des Treibhausgas-Ausstoßes. Methan gilt als vielfach klimaschädlicher als CO2. Deswegen ist ein Kilo Rindfleisch nach einer Studie im Auftrag des Umweltbundesamts mit einem Ausstoß von 13,6 Kilo CO2-Äquivalent eines der klimaschädlichsten Lebensmittel. Selbst Ananas aus der Dose (1,8 Kilo CO2-Äquivalent) oder Palmfett (2,9 Kilo) schneiden in der Studie deutlich besser ab.
Pasi Vainikka, Co-Gründer des finnischen Start-ups Solar Foods, sagt: „Solein ist eins der wenigen Lebensmittel, das ganz ohne Landwirtschaft auskommt.“ In der Produktion werde nicht nur viel weniger CO2 ausgestoßen, sondern die Luft werde sogar von Treibhausgasen befreit. Die Pilotanlage in Finnland produziert zwar nur ein Kilogramm Solein pro Tag und entnimmt der Luft rund zwei Kilogramm CO2. „Das ist gemessen am Treibhausgasausstoß der Lebensmittelindustrie sehr wenig“, sagt Vainikka. Doch die Testanlage zeigt, dass das Verfahren funktioniert.
Die erste Anlage nimmt in diesem Jahr den Betrieb auf, ab 2024 soll sie Gewinn erwirtschaften. Für den Bau erhielt das finnische Jungunternehmen im Dezember 34 Millionen Euro über den Fördertopf für so genannte „Important Projects of Common European Interests“ von der Europäischen Union (EU) und damit die bislang weltweit größte öffentliche Förderung der zellulären Landwirtschaft, also jenes Forschungsgebiets, bei dem Wissenschaftler Lebensmittel im Reagenzglas aus Zellen herstellen.
Kürzlich erhielt Solar Foods außerdem eine Verkaufszulassung in Singapur, sagt Vainikka.
Grüne Baustoffe und Bodenverbesserer aus CO2
Auch Kompost, Grünschnitt, Holz und Gülle sind CO2-Emittenten. Das Maschinenbauunternehmen Pyreg zum Beispiel stellt eine Anlage her, die CO2-haltige Biomasse-Reststoffe in wertvolle Pflanzenkohle – Biochar – umwandelt. Dabei wird die Biomasse unter Luftentzug und hohen Temperaturen in sogenannten Karbonisierungsanlagen in Kohlenstoff umgewandelt. So wird verhindert, dass ein Großteil des in der Biomasse enthaltenen CO2 in die Atmosphäre entweicht.
Die Pflanzenkohle wird etwa in der Landwirtschaft eingesetzt, um den Boden mit Nährstoffen anzureichern, sowie in der Industrie als Bestandteil von Baustoffen verwendet. Dort ist das CO2 „über Jahrtausende sicher gespeichert“, sagt Pyreg-CEO Jörg zu Dohna. Würde man den Grünschnitt stattdessen verrotten lassen, würde das während der Wachstumsphase der Pflanzen gespeicherte CO2 wieder freigesetzt. Eine Tonne Biochar bindet dauerhaft knapp drei Tonnen CO2 pro Jahr.
Die Anlage hat einen weiteren Vorteil: Im Verkohlungsprozess entsteht Wärme. Das Industrieunternehmen Thyssen-Krupp Rothe Erde, das Großwälzlager produziert, hat eine Anlage am Produktionsstandort Lippstadt installiert. Sie decke dort etwa 40 Prozent des Wärmebedarfs für Heizung und Wasser der Produktionshallen, Büro- und Sozialräume ab, sagt Wilfried Spintig, COO bei Thyssen-Krupp Rothe Erde. Das entspricht – zum Vergleich – dem jährlichen Bedarf von knapp 180 Vierpersonenhaushalten.
Thyssen-Krupp Rothe Erde nutzt Holz aus Verpackungsresten. Aus jährlich rund 2500 Tonnen Restholz entstehen so über 5300 Megawattstunden Wärme und rund 640 Tonnen Biochar.
Kerosin aus der Sonne
Über synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, wurde in den letzten Monaten viel diskutiert. Alternativen zu Benzin, Diesel, Gas oder Kerosin sollen dabei ausschließlich mit erneuerbaren Energien hergestellt werden, indem aus Wasser zunächst Wasserstoff und anschließend mithilfe von CO2 flüssiger Kraftstoff hergestellt wird.
VW-Chef Oliver Blume warb zuletzt beim Autogipfel im Kanzleramt im Januar für die Technologie. „Ottomotoren können mit ihnen nahezu CO2-neutral betrieben werden. So können alle Fahrzeuge ihren Teil dazu beitragen, CO2 zu reduzieren – unabhängig von der Antriebsart“, sagte er. Davon würden auch Bestandsfahrzeuge profitieren. E-Fuels würden sich „als Wasserstoff-Derivat hervorragend mit fossilen Kraftstoffen mischen“ lassen, so der VW-Chef.
Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) sieht das ähnlich. „Wir brauchen auch hier Technologieoffenheit“, sagte sie im Zuge des Streits um die Wasserstoff-Strategie der Ampelkoalition. Wir geben Klimaneutralität vor, aber die Ingenieure entwickeln den Plan, und die E-Fuels sind ein Weg, CO2 einzusparen und klimaneutral zu werden.“
Doch die Technologie ist durchaus umstritten: Bislang ist der Wirkungsgrad sehr gering. Nur 15 Prozent der Energie können für den Antrieb genutzt werden, der Rest geht verloren. Bei Elektroautos sind es immerhin rund 70 Prozent. Man benötigt also die fünffache Energiemenge, um mit E-Fuels die gleiche Strecke wie mit einem E-Auto zurückzulegen.
Wissenschaftler des Schweizer Start-ups Synhelion, einer Ausgründung der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich, arbeiten an einem anderen Verfahren, Treibstoffe CO2-neutral herzustellen. Das Unternehmen nutzt statt Strom unmittelbar Solarwärme, um CO2 in synthetische Kraftstoffe umzuwandeln.
Ende des Jahres geht die erste Anlage in Jülich an den Start, ab 2026 nimmt in Spanien eine zweite Anlage ihren Betrieb auf. Die Anlage in Spanien soll rund 1000 Tonnen Treibstoff pro Jahr produzieren, kündigt der Co-Gründer Gianluca Ambrosetti an. Dann müsse sich die Produktionsmenge mit jeder Anlage vervielfachen, um bis 2030 einen relevanten Beitrag auf dem Weg zu nachhaltigen Treibstoffen zu leisten.
Im Jahr 2030 sollen bereits 875 Millionen Liter Kerosin, Benzin oder Diesel entstehen, die Produktion eines Liters soll dabei perspektivisch weniger als einen Euro kosten. Am Unternehmen beteiligt ist unter anderem die zur Lufthansa-Gruppe gehörende Schweizer Luftfahrtgesellschaft Swiss International Airlines.
CO2-Recycling in der Heizung
Das kanadische Start-up CleanO2 verwandelt CO2 in Seife und Waschmittel. Die Gründer haben ein Gerät erfunden, das Treibhausgase aus Gebäudeheizungen und Warmwasseraufbereitern abspeist und in Kaliumkarbonat, sogenannte Perlasche, verwandelt. Dieser Stoff dient als Vorprodukt bei der Herstellung von Seife und Waschmitteln.
Eine Anlage hat ungefähr die Größe von zwei Kühlschränken und bindet nach Angaben des Unternehmens sechs bis acht Tonnen CO2 im Jahr. Das entspricht etwa der Wirkung von 300 Bäumen.
Mit der Wiederverwertung von CO2 setzte sich Jaeson Cardiff, Co-Gründer und CEO von CleanO2, bereits 2005 auseinander. „Auf dem Markt gab es keine klaren Lösungen für den Umgang mit Kohlenstoffemissionen“, sagt er. Cardiff arbeitete zu der Zeit als Klempner und Heizungstechniker und erkannte, dass sich mit dem chemischen Gemisch, das üblicherweise zur Reinigung von Heizkesseln verwendet wird, auch CO2 abscheiden ließ.
Im Jahr 2013 gründeten er und sein Team CleanO2 in Kanada. Heute liefert das Unternehmen seine Maschinen innerhalb des Landes, in die USA und nach Japan. Sie kommen vor allem in gewerblichen und privaten Immobilien zum Einsatz, die mit Erdgas beheizt werden, etwa in Hotels und Zentren für betreutes Wohnen.
Klimatechnologien haben ihren Preis
Um den Klimawandel aufzuhalten, wird es allerdings nicht genügen, den CO2-Ausstoß zu senken. Vielmehr braucht es neue Technologien in allen CO2-intensiven Branchen, die dabei helfen, Kohlenstoff aus der Luft zu entfernen und ihn für neue Produkte wiederzuverwerten. Die Nachfrage nach den Karbonisierungsanlagen von Pyreg ist in den vergangenen zwei Jahren sprunghaft angestiegen. Über 50 Anlagen sind in Deutschland und weltweit im Einsatz und entziehen der Atmosphäre jährlich 30.000 Tonnen CO2. Das entspricht der Klimaleistung von 2,4 Millionen Bäumen. Die Technologie hat ihren Preis: Eine Anlage kostet rund zwei Millionen Euro.

