Viel Druck, kaum Anerkennung – das Dilemma der Mittelmanager
Firmen dünnen ihr Mittelmanagement aus. Für Chefs bedeutet das: mehr Mitarbeiter – und sogar einige aus anderen Bereichen. Wie gelingt Führung trotzdem?
An Wochentagen war er bis spätabends im Einsatz. Samstags und sonntags saß er auch meist am Schreibtisch. Mehr als 80 Stunden pro Woche arbeitete Stefan Bründl damals als Vertriebsleiter bei einem Personaldienstleister. Und kam selten dazu, grundsätzlich über seinen Job nachzudenken. Zum Beispiel über die Frage, wie sinnvoll es war, dass er als Führungskraft mittlerweile für mehr als ein Dutzend Teams verantwortlich war. Oder darüber, dass seine Chefs ihm immer neue Aufgaben gaben. Er habe erwartet, dass sich sein Einsatz irgendwann auszahlen werde, sagt der 47-Jährige. Heute sieht er das anders: „Ich habe für zwei gearbeitet, und es wurde null wertgeschätzt.“
Viel Druck, wenig Anerkennung – das ist ein grundsätzliches Dilemma von Führungskräften auf der mittleren Ebene. Doch es kommt in wirtschaftlich schwierigen Zeiten stärker zum Tragen. Viele Firmen dünnen derzeit gezielt das mittlere Management aus. Der Chemiekonzern Bayer will agiler werden – und allein in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres hat das Unternehmen etwa 2500 Posten gestrichen. Bei Evonik sollen von 4500 Führungskräften 1000 gehen, die Zahl der Mitarbeiter pro Führungskraft von eins bis vier auf sieben erhöht werden. Und auch der Automobilzulieferer Brose sowie der Onlinehändler Amazon haben angekündigt, Führungskräften größere Teams zuzuweisen.

Wo der Frust aufläuft
Der Führungsstil und die Erfahrung der Beschäftigten, die Komplexität der Aufgaben und die Art, wie eingespielt ein Team ist – all das beeinflusst, für wie viele Mitarbeiter ein Chef idealerweise verantwortlich sein sollte. Die Managementberatung Kienbaum nennt sieben bis zehn Mitarbeiter pro Führungskraft als Richtwert. Lange war das Prestige eines Managementpostens eng verbunden mit dieser Zahl. Je höher, desto besser. Wer über viele Leute verfügt, besitzt Macht. Doch wenn Teams vor allem wachsen, weil das Mittelmanagement geschliffen wird, bekommen Führungskräfte oft auch frustrierte Mitarbeiter dazu – im schwierigsten Fall aus Fachbereichen, von denen sie wenig Ahnung haben. Daraus ein neues Team zu formen ist schwer. Erst recht in Zeiten, in denen die Ziele ambitionierter werden.
Die Coachin Ariane Beutner, die Firmen aus verschiedenen Branchen unterstützt, erlebt derzeit nicht nur viele solcher Restrukturierungen, sondern auch, dass selbst Firmen, die Stellen im Mittelmanagement nicht gezielt abbauen, dort frei werdende Posten nicht nachbesetzen. Immer mehr Teamleiter, die sie betreue, verantworteten nicht mehr nur einen, sondern zwei oder drei Fachbereiche. Viele Firmen unterschätzten, wie häufig das zu Konflikten führe. „Oft gibt es kulturelle Unterschiede zwischen den Teams oder zu wenig Vertrauen in die neue Führungskraft – erst recht wenn sie fachfremd ist.“
👉Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen
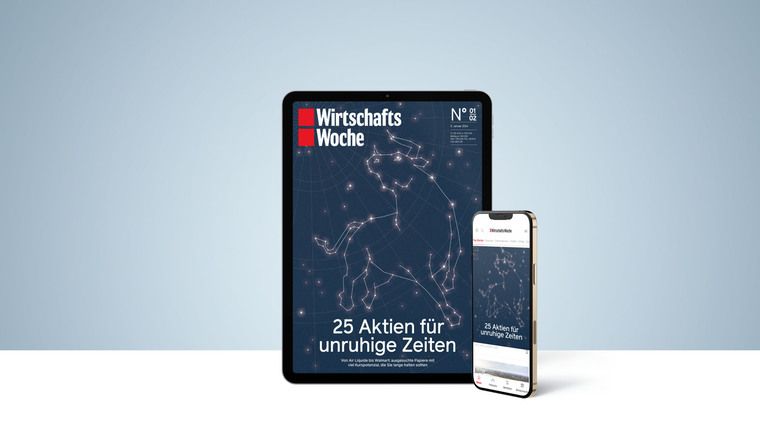
Aus ihrer Sicht sollten sich Chefs gut überlegen, welche Teams nicht nur fachlich, sondern auch menschlich zusammenpassen. Und sie sollten ihren Führungskräften eine echte Wahl lassen, ob diese sich die gestiegene Verantwortung zutrauen: „Wenn Manager und Managerinnen einer Restrukturierung nur zustimmen, um nicht abgesägt zu werden, ist das eine schlechte Basis.“ Die Gefahr, dass diese dann schnell gestresst sind und Konflikte verschärfen, statt sie zu lösen, sei groß. Und das mache erhoffte Effizienzgewinne zunichte.
Das hat auch Vertriebsleiter Stefan Bründl erlebt: Die Probleme begannen, als sein Arbeitgeber vor fünf Jahren das Unternehmen, in dem er war, mit einem anderen Tochterunternehmen fusionierte. Der Manager bekam dadurch zu seinen acht Vertriebsteams vier weitere dazu. Er hatte zuvor für seine Kundschaft schon Stellen mit IT-Freiberuflern besetzt, nun vermittelte er zusätzlich Leiharbeiter.
Aus ihrer Sicht sollten sich Chefs gut überlegen, welche Teams nicht nur fachlich, sondern auch menschlich zusammenpassen. Und sie sollten ihren Führungskräften eine echte Wahl lassen, ob diese sich die gestiegene Verantwortung zutrauen: „Wenn Manager und Managerinnen einer Restrukturierung nur zustimmen, um nicht abgesägt zu werden, ist das eine schlechte Basis.“ Die Gefahr, dass diese dann schnell gestresst sind und Konflikte verschärfen, statt sie zu lösen, sei groß. Und das mache erhoffte Effizienzgewinne zunichte.
Das hat auch Vertriebsleiter Stefan Bründl erlebt: Die Probleme begannen, als sein Arbeitgeber vor fünf Jahren das Unternehmen, in dem er war, mit einem anderen Tochterunternehmen fusionierte. Der Manager bekam dadurch zu seinen acht Vertriebsteams vier weitere dazu. Er hatte zuvor für seine Kundschaft schon Stellen mit IT-Freiberuflern besetzt, nun vermittelte er zusätzlich Leiharbeiter.
„Häufig“, sagt Coachin Ariane Beutner, „wird das mittlere Management mit solchen Herausforderungen allein gelassen.“ Aus ihrer Sicht hätte Bründls Chef eingreifen, dem Manager den Rücken stärken, den Mitarbeitern klarmachen müssen, dass die Zahlen nötig sind. Und Bründl hätte Entlastung gebraucht, um sich mehr dem Austausch im Team widmen zu können, sagt sie.
Noch wichtiger sei das für Manager, die Mitarbeiter mit einem anderen fachlichen Zuschnitt führen sollen. So wie jemand, den Beutner beraten hat, Anfang 40, Vertriebsleiter bei einem Konsumgüterhersteller. Er bekam zusätzlich das Marketing übertragen. Die Abteilungen sollten sich enger und schneller austauschen. Für den Manager wirkte die Aufgabe überschaubar. Schließlich waren sowohl Vertrieb als auch Marketing Teil seines Betriebswirtschaftsstudiums gewesen. „Genau das war aber der Denkfehler“, sagt Beutner. „Sowohl der Manager als auch der Vorstand hielten die Veränderung für keine große Sache.“ Die Belegschaft sah das ganz anders: Die Marketingleute trauten dem neuen Chef wenig zu.
Schnell knirschte es. Im Marketing haderten viele mit den ersten Entscheidungen ihres Vorgesetzten und hatten zudem den Eindruck, er schätze sie nicht so sehr wie den Vertrieb. Und der Austausch zwischen den beiden Bereichen wurde auch nicht besser. Die Marketingexperten entwarfen weiterhin Kampagnen ohne die Erkenntnisse aus dem Vertrieb, welche Produkte sich wo gut verkauften. Danach begannen die Schuldzuweisungen. Der Vertrieb warf dem Marketing vor, nicht nachgehakt zu haben. Das Marketing beklagte sich, dass der Vertrieb keine Zahlen geliefert habe. „Solche Konflikte lassen sich nachträglich nur sehr schwer auflösen.“ Im schlimmsten Fall bringen sie für Führungskräfte einen Karriereknick.
Beutner legt Führungskräften deshalb ans Herz, die richtigen Prioritäten zu setzen. Es sei ein typischer Reflex, sich schnell in neue Bereiche einarbeiten zu wollen. Wichtiger aber sei es, neue Mitarbeiter zunächst menschlich für sich zu gewinnen. „Das Fachliche kommt danach – auch wenn es schwerfällt.“ Sie rät Managern, sich in Einzelgesprächen sowohl mit den alten als auch mit den neuen Mitarbeitern zusammenzusetzen: Was halten sie von der Restrukturierung? Welche Sorgen, welche Hoffnungen verbinden sie damit? Was lief früher gut, was kann in Zukunft besser werden? „Gerade Mitarbeitern, die noch stark an der alten Struktur oder an ihrer alten Führungskraft hängten, hilft das, sich auf das Neue einzulassen.“
Zeit, um Ängste Abzubauen
Wie viel eine ebenso offene wie klare Kommunikation zwischen den Hierarchieebenen bringen kann, hat Markus Groß erlebt. Der Manager, der für einen Futtermittelhersteller arbeitet, heißt eigentlich anders, möchte aber weder seinen eigenen Namen, noch den seines Arbeitgebers in der Zeitung lesen. Das Unternehmen muss sparen und hat deshalb Stellen im mittleren Management nicht nachbesetzt und Bereiche zusammengelegt. Markus Groß leitet seit zehn Jahren ein Team, das wichtige Produktdaten sammelt und für alle anderen Abteilungen aufbereitet, vor knapp einem Jahr hat er zudem die Leitung der Grafikabteilung übernommen, die die Verpackungen der Futterdosen gestaltet. Statt bislang drei führt er seitdem zehn Mitarbeiter. „Für mich war das eine große Veränderung“, sagt Groß.
Er habe sich am Anfang viel Zeit genommen, um den Mitarbeitern Sicherheit zu geben, erzählt Groß. Die Restrukturierung sei in eine unruhige Zeit gefallen: Die Firma arbeite an einem neuen Markenauftritt, wolle jünger und moderner wirken. Außerdem wurden in einigen Auslandsgesellschaften Stellen gestrichen. „Natürlich gab es Sorgen im Team, dass das auch in Deutschland passieren könnte.“ Groß' Bereichsleiter und er sprachen diese Befürchtungen bei einem Meeting mit beiden Abteilungen offen an und betonten, dass dort niemand seinen Job verlieren werde. Kurz darauf traf sich Groß noch mal mit seinen beiden Teams, um detaillierter auf Sorgen einzugehen. Dadurch hätten Mitarbeiter weniger Angst vor der Veränderung gehabt und eher deren Vorteile im Alltag gesehen: dass Absprachen einfacher wurden etwa.
Zudem habe Groß seinen Führungsstil verändert: Früher habe er etwa 70 Prozent seiner Arbeitszeit noch selbst in Projekten mitgearbeitet und sei über den Stand stets bestens informiert gewesen. Diesen Anspruch könne er nicht mehr erfüllen – müsse er aber auch nicht, sagt der 47-Jährige. Er konzentriere sich darauf, Prozesse zu optimieren. Er stelle sicher, dass es reibungslos laufe in seinen Teams. Und er behalte im Blick, dass sich diese gut ins Unternehmen einfügen.
Dass Groß mehr Verantwortung übernehmen kann, ohne sich aufzureiben, liegt auch an seiner Geschäftsführung. „Die hat ein offenes Ohr, wenn es doch mal zu viel wird“, betont der Manager. Als er mit anderen Teamleitern der Chefetage vor Kurzem klarmachten, dass einige Termine für die Modernisierung der Marke zu ambitioniert waren, stellte die Geschäftsführung die Überarbeitung bestimmter Produktgruppen zurück. Gemeinsam einigte man sich auf einen besseren Zeitplan. Eine solche Haltung der Chefs sei wichtig, sagt Coachin Ariane Beutner. Sonst bleibe mittleren Managern manchmal nur die Trennung.
Stefan Bründl hat seinen Arbeitgeber, den Personaldienstleister, vor gut zwei Jahren verlassen. Rückblickend eine Befreiung, sagt er. „Ich war Teil eines internationalen Entwicklungsprogramms für Führungskräfte und dachte lange Zeit, dass ich die Probleme in meinem Bereich lösen muss, um zu beweisen, dass ich mit solchen Herausforderungen umgehen kann.“ Erst einige Zeit später habe er erkannt, dass viele Probleme, mit denen er sich herumschlug, strukturell im Unternehmen verankert waren. Immerhin, er hat dadurch wertvolle Erfahrung gewonnen: Mittlerweile ist er selbstständig und berät mit seinem Unternehmen Leadsimply Start-ups und mittelständische Unternehmen, gute Führungsstrukturen aufzubauen.
👉Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen
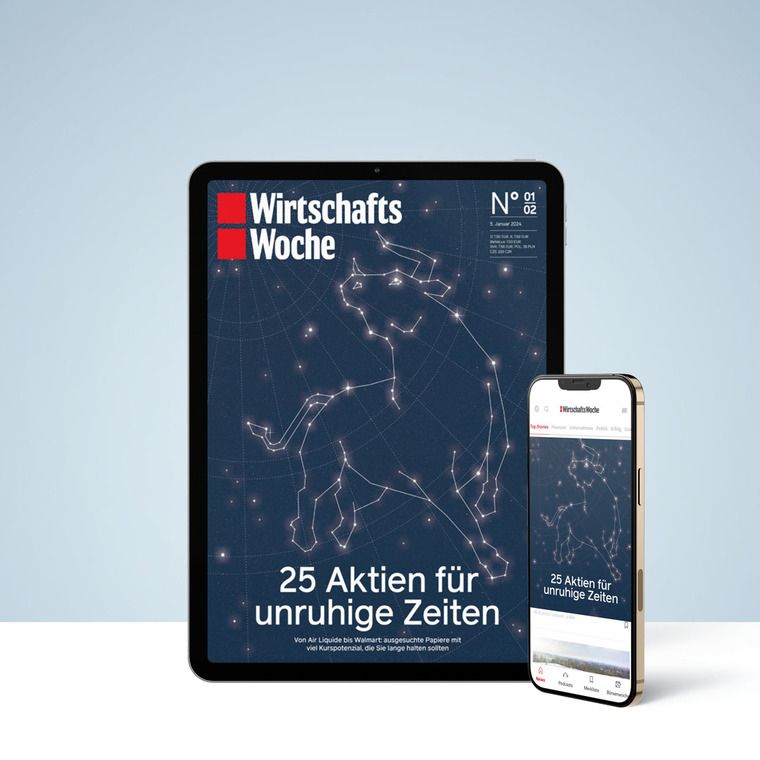
👉Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen

