Warum ausgerechnet Hochbegabung oft ein Karriere-Hindernis ist
Hochbegabte haben es im Job oft schwer. Wie sie Chefs von sich überzeugen, ohne sie zu übertrumpfen.
Im schlimmsten Fall greift Claus Melder zur Ehemann-Methode. Ziemlich perfide, aber manchmal notwendig, erklärt er seinen Zuhörern in einem Seminarraum in Duisburg: „Du sollst spülen, lässt den Lieblingsteller der Frau fallen – und musst nie wieder spülen.“ So ähnlich funktioniere das auch im Büro, wenn der Chef einem eine unliebsame Aufgabe aufdrückt. Ein kalkuliertes Missgeschick, unter dem vielleicht der Ruf, besonders zuverlässig zu sein, leidet. Dafür aber wird man nicht mehr mit jedem Kleinkram behelligt.
Wenn der Chef nervige Zusatzaufgaben stets jenen aufbrummt, die sich nicht schnell genug wegducken und, ohne zu murren, jedes Thema übernehmen, hemmt das ihre Karriere – und es bedarf ungewöhnlicher Maßnahmen. Viele der Menschen, die vor Karriereberater Melder sitzen, kennen das. Sie könnten Großes bewirken und sollten nicht kleingehalten werden. Sie haben einen außergewöhnlich hohen Intelligenzquotienten (IQ), sind wissbegierig, sachorientiert, hilfsbereit. Und manchmal von allem etwas zu viel. Deswegen ist ihr Thema an diesem Mittag: Wie kann man trotz Hochbegabung Karriere machen?
Dass schlaue Menschen automatisch auch beruflich erfolgreich sind, ist ein Trugschluss. Ihre Intelligenz ist eine sehr gute Voraussetzung dafür, aber oft macht ihnen das Zwischenmenschliche einen Strich durch die Rechnung. Laut einer Erhebung des Hochbegabtenvereins Mensa neigen dessen Mitglieder etwas mehr zu Autismus als andere. Gleichzeitig nehmen Kollegen und Chefinnen Hochbegabte viel stärker als Eigenbrötler und verschlossene Individualisten wahr, als sie es tatsächlich sind. So bleiben sie unter ihren Möglichkeiten. Das ist nicht nur für sie ärgerlich, sondern auch für ihre Arbeitgeber, die viel Potenzial verschenken. Und so hilft es allen Seiten, wenn die IQ-Meister Techniken anwenden, mit denen sie ihren Chef von sich überzeugen – ohne ihn gleich zu übertrumpfen.
In Deutschland liegt der durchschnittliche IQ bei rund 100, gut zwei Drittel der Bevölkerung kommen auf einen Wert zwischen 85 und 115. 1,8 Millionen haben einen IQ von über 130, etwa zwei Prozent. Sie sind intellektuell hochbegabt. Noch aber ist der Begriff sehr klischeebehaftet. Laut der Psychologin und Intelligenzforscherin Tanja Gabriele Baudson ist Hochbegabung „ein Trigger für Ressentiments, gerade im leistungsbezogenen Arbeitsumfeld“. Die Mensa-Vorstandschefin kennt viele Fälle von Neid und Missgunst. Jemand, der von der Hochbegabung eines anderen hört, könnte sich eingeschüchtert fühlen, um seine Aufstiegschancen bangen und eher auf Konfrontation setzen oder gar versuchen, den Kollegen hinterrücks auszustechen. Baudson rät deswegen davon ab, sich zu outen, „wenn nicht eine entsprechende Leistung dahintersteht“. Wer über seinen herausragenden IQ spricht, sollte zuerst herausragende Arbeit leisten.
Jetzt 6 Ausgaben der WirtschaftsWoche kostenlos lesen – Zum Angebot
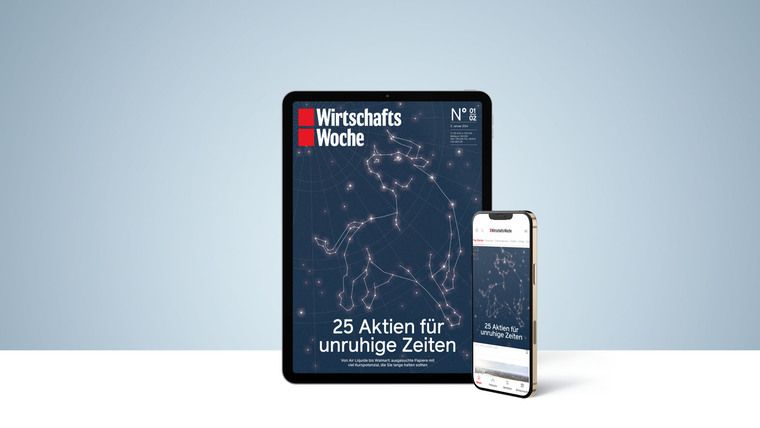
Jetzt 6 Ausgaben der WirtschaftsWoche kostenlos lesen – Zum Angebot
Hochbegabte wirken mitunter wie Streber
Claus Melder ist gelernter Schlosser und Maschinenbauer und war 20 Jahre in der Geschäftsleitung des Breisgauer Sensorenherstellers Sick tätig. Er hat Karriere gemacht. Er war bereits 42, als er bemerkte, dass er hochbegabt ist, mit einem IQ von über 145 sogar höchstbegabt. Heute berät er andere Hochbegabte, wie sie beruflich vorankommen und mit Problemen im Job umgehen. Was vielen von ihnen oft fehle, sagt Melder: „taktisches Gespür“. Menschen wie er neigten dazu, ungefragt Verbesserungsvorschläge zu machen. Dabei sei es klug, Chefs auch mal nicht zu widersprechen, obwohl man es besser weiß. Zu überlegen, welchen Kampf es sich wirklich zu kämpfen lohnt – und was Vorgesetzte davon haben. „Man bekommt eben viel mehr Aufmerksamkeit, wenn das, was man tut, auf das Konto der Führungskraft einzahlt“, sagt Melder.
Ein Gefühl dafür zu entwickeln, wann man den Vorgesetzten wie stark hinterfragen, provozieren, verbessern kann, ist für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter wichtig. Doch Hochbegabten fällt das schwerer. Sie haben etwas, das in unserer Gesellschaft gerne als Authentizität gefordert und doch selten praktiziert wird: Wahrhaftigkeit. Sie folgen der Devise: Argument vor Geschäftslogik. Sie denken weniger an das Ziel und daran, wie man unter Berücksichtigung aller Widrigkeiten, im eigenen Unternehmen und von Kundenseite, am geschicktesten und schnellsten dorthin kommt. Sondern an die perfekte Lösung in einer perfekten Welt. An eine Utopie.
Die Gefahr für die Detailgenauen: Wenn sie zu sehr im Klein-Klein aufgehen, stempeln ihre Chefs sie womöglich als Nerds ab. Sie setzen sie dann nur noch für technische Fragestellungen ein, für die Details, mit denen alle anderen in Ruhe gelassen werden wollen.
Hochbegabten fällt es schwer, zu rasten. Durch ihren Tatendrang, Nachfragerei oder Besserwisserei wirken sie mitunter wie Streber. Dabei sind sie meist schlichtweg nicht ausgelastet. Sie haben oft einen eher langweiligen Job, aber unzählige Hobbys. Das wohl berühmteste Beispiel: „Einstein hat im Patentamt gearbeitet – und die Relativitätstheorie erfunden“, sagt Melder. Er selbst schreibt in seinem Vorruhestand Kindermärchen, gibt Univorlesungen, hilft ehemaligen Häftlingen bei der Wiedereingliederung und arbeitet als Karrierecoach.
Lebenslanges Lernen sei unter Mensanern, wie sich die Mitglieder des Hochbegabtenvereins nennen, keine leere Phrase, betont Baudson. Viele setzten auf ihren Abschluss noch einen zweiten, dritten oder gar vierten drauf. Die Vereinsvorsitzende hat immer wieder erlebt, dass Mitglieder bei Stammtischen von einem Thema zum nächsten und von da zum übernächsten springen. Weil ihre Interessen so vielfältig sind. „Und manchmal setzt man sich einfach wieder in den Hörsaal.“ Diesen Tatendrang sollten Führungskräfte anerkennen und fördern, statt ihn als Angriff auf die eigene Position zu verstehen und zu blockieren.
Aber dieses Verständnis, dass es Hochbegabten selten darum geht, jemanden zum eigenen Vorteil bloßzustellen, ist keine Selbstverständlichkeit. Baudson hat als Studentin im Studentenwerk gearbeitet. Sie musste Mietverträge aufsetzen und Studenten und Studentinnen Restplätze vermitteln. „Es war manchmal der totale Trubel. Um 12.00 Uhr mittags waren alle platt.“ Sie aber nicht. Sie hatte ein Bedürfnis nach Stimulation, nach mehr Verträgen sozusagen. Man müsse aufpassen, sagt Baudson, „das anderen nicht aufs Brot zu schmieren. Denn das wird zum Problem, wenn sie sich dadurch herabgesetzt fühlen.“
Gern gesehene Ausputzer
Claus Melder präsentiert in dem Seminarraum in Duisburg seine Folien. Ganz wichtig, ruft er: „Nicht schlaumeiern.“ Sonst erbe man Aufgaben, „auf die man keine Lust hat“. Nach dem Motto: Ach, wenn du dich so gut damit auskennst, kümmere dich darum! Eine Seminarteilnehmerin berichtet, sie könne zwar eigenständig arbeiten und erfahre Dankbarkeit von den Kollegen. Aber in Wahrheit erledige sie nur die undankbaren, technischen Aufgaben. „Ich sitze da fünf Tage und habe überschaubare Ergebnisse. Ich hätte viel größere Ergebnisse, wenn ich die Abteilung führen würde und jemand anderes den Mist macht“, sagt sie.
Wie löst sie das auf? Wie macht sie aus Lose-lose Win-win? Melder empfiehlt, stärker zu überlegen, was der Kunde von ihrer Arbeit hat, und dies gegenüber dem Chef zu betonen: vom Ergebnis ganz am Ende erzählen, nicht von der lästigen Arbeit, von der die Führungskraft womöglich nichts verstehe. Es sei wichtig, auch auszusprechen: Ich möchte Karriere machen.
Nutzt der Chef aus, dass jemand pflichtbewusst ist, und drückt einem immer wieder unliebsame Aufgaben auf? Melder kennt da noch ein paar Tricks. Eine Möglichkeit zur Abwehr: „Ich mache das gerne, aber ich brauche dafür 20.000 Euro.“ Budget oder Mitarbeiter zu fordern, führt laut Melder oft dazu, dass Führungskräfte ihr Vorhaben noch mal überdenken. So wird man die Anfrage schnell wieder los. Ebenso unbeliebt bei Managern: der Verweis auf die Rechtsabteilung oder die Qualitätssicherung. Mit juristischen oder qualitativen Zweifeln wollen Chefs in der Regel nichts zu tun haben, argumentiert Melder. Und wenn das alles nichts hilft, muss die Ehemann-Methode herhalten. Nur überstrapazieren sollte man diese Herangehensweise nicht – weder im Büro noch in der heimischen Küche.
Transparenzhinweis: In einer früheren Version dieses Artikels hieß es, Hochbegabte neigten allgemein mehr zu Autismus als andere. Richtig ist, dass dies nur für die Teilgruppe der Mitglieder des Hochbegabtenvereins Mensa gilt, die nicht repräsentativ ist.
Jetzt 6 Ausgaben der WirtschaftsWoche kostenlos lesen – Zum Angebot
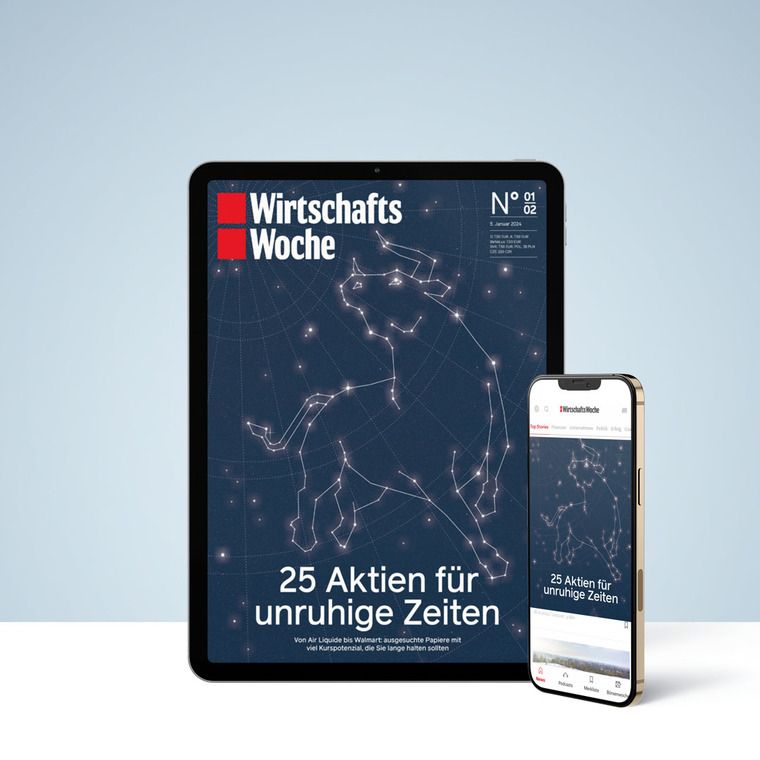
Jetzt 6 Ausgaben der WirtschaftsWoche kostenlos lesen – Zum Angebot

