Warum Start-ups keine Start-ups mehr sein wollen
Start-ups? Sind total cool! Und doch meiden immer mehr Gründer den Begriff. Aus guten Gründen.
Der Darth Vader aus Legosteinen trägt eine Sonnenbrille. Und das überdimensionale Plüschtier einen schwarzen Kapuzenpullover. Dies ist so ziemlich das Einzige in den Büros der Aachener Firma Safion, das direkt darauf hindeutet, dass hier ein junges Team für ein Unternehmen arbeitet, das es erst seit 2019 gibt.
Das in Braun und Grau gehaltene Bürogebäude ähnelt von außen dem Sitz einer Behörde. Im Treppenhaus zieht eine Sammlung alter Radios in Holzgehäusen die Blicke auf sich. Im Konferenzraum stehen kleine Saftfläschchen auf grellgrünen Servietten.
Alles reichlich unspektakulär – und damit ganz nach dem Geschmack von Chef Alexander Gitis. Ein hippes Start-up? Das seien sie nicht. Ganz und gar nicht. Wenn Gitis Start-up hört, denkt er an „ineffizientes“ Wachstum nur dank üppiger Finanzierungsrunden, an Geschäftsmodelle wie Tinder für Katzen. Zwar haben er und seine Kollegen ein Gründerstipendium erhalten – und einen Investor an Bord ihrer Firma, in der sie an Technik zur Prüfung von Batterien arbeiten. Gitis aber begreift Safion als Technologiefirma, deren Wachstum er gerade mit Umsätzen finanziert. Und das Jobs in der Region schaffen soll. Global denken, lokal handeln, laute das Motto. „Wie ein neuer Mittelständler.“
SILICON VALLEY? BLOSS NICHT!
Die Abgrenzung ist ihm wichtig. Und nicht nur ihm. Als drei Forscher von Universitäten in den USA und Australien Firmengründer fragten, was sie neuen Bekannten über ihren Beruf erzählen, stellten sie fest: Überraschend viele mieden bewusst den englischen Begriff Entrepreneur. Weil er überstrapaziert und überbewertet sei. Weil er ihnen zu sehr nach Silicon Valley klinge, wo viele allein auf den Exit aus seien und es häufig nur um „irgendeine Webseite oder App“ gehe, wie ein Befragter zu Protokoll gab.
💡Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen
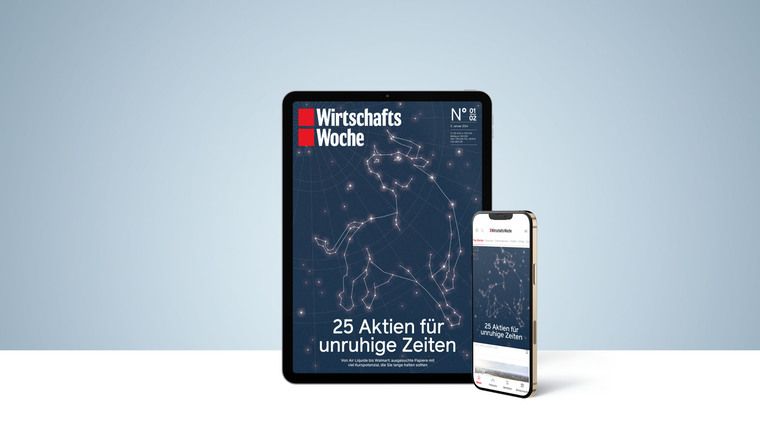
Für diese Abgrenzung gibt es gerade jetzt gute Gründe. Start-ups haben einen schweren Stand. Finanzierungsrunden fallen kleiner aus, Firmen wie Lilium und der Medikamentenlieferant Mayd schlittern in die Insolvenz. Der Ansatz, möglichst schnell zu wachsen und erst eines fernen Tages Geld zu verdienen, funktionierte in einer Zeit, in der es wirtschaftlich aufwärtsging. Doch jetzt? Statt „to the moon“ muss „to the sky“ genügen.
Felix Oldenburg hat vor vier Jahren seine Firma Bcause gegründet, mit der er das angestaubte Stiftungswesen „disrupten“ will, wie er sagt. 14 Leute arbeiten für ihn. Gerade erst hat er fast fünf Millionen Euro Risikokapital eingesammelt. Und doch hadert auch er mit dem Begriff Start-up. Einerseits sei er „schillernd“, verschaffe Aufmerksamkeit. Mut, Innovation, Schnelligkeit – all das schwingt mit. Bei Investoren und Journalisten verfange das. „Aber er steht uns an anderer Stelle im Weg“, sagt Oldenburg.
Seine Kunden sind vermögend. Und wollen einen Teil des Geldes über Bcause stiften, spenden, investieren. Wenn er seine Firma Start-up nennen würde, so glaubt er, wären die Leute zurückhaltend – auch wenn er begründen könne, dass das Geld sicher verwahrt und angelegt sei. „Wir machen keine Dating-App und keinen Pizzalieferdienst. Vertrauen ist für uns ein zentraler Wettbewerbsvorteil.“ Seine Kunden wollen sichergehen, dass es Bcause noch lange Zeit gibt. „Und für manche Leute vermittelt der Begriff Start-up noch immer das Gegenteil“, sagt Oldenburg.
BESSER ETWAS ZEIT LASSEN
Auch Gitis ist überzeugt, dass seine Kunden nicht mit ihm sprechen würden, wenn er Safion als Start-up präsentiere. Immerhin richtet er sich an die größten Auto- und Techkonzerne. „Die Produkte müssen überzeugen“, sagt Gitis und erzählt, dass seine Geräte für eine Diagnose der Batterien nur wenige Sekunden benötigten – und manche Konkurrenten sogar mehrere Minuten. Also: lieber ausgefeilte Produkte für renommierte Kunden entwickeln, statt mit unausgereiften Prototypen so schnell wie möglich auf Kundenfang zu gehen.
Dass Gründern in Deutschland daran mehr und mehr liegt, zeigt sich auch in der Befragung des Start-up-Monitors: 2021 war ihnen schnelles Wachstum noch wichtiger als Profitabilität. Drei Jahre später begriffen fast drei Viertel der Start-ups die Profitabilität als sehr wichtiges Ziel, nur noch etwas mehr als die Hälfte setzte seine Prioritäten auf schnelles Wachstum.
💡Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen
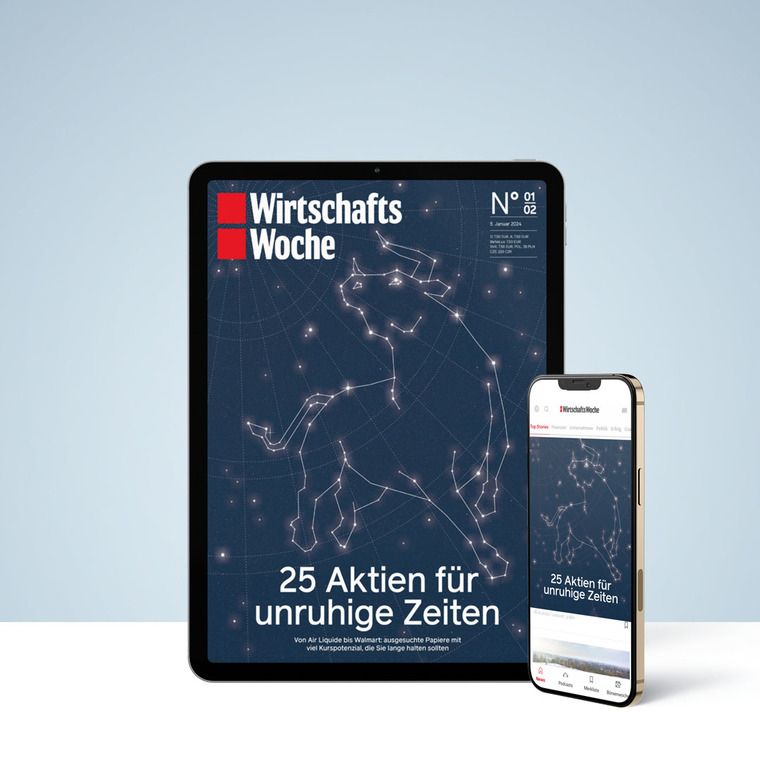
Und das könnte sich auszahlen. Als zwei Forscher der Universität von Pennsylvania mehr als sechs Millionen Stellenanzeigen von fast 40.000 Start-ups analysierten, zeigte sich: Stellten die Firmen schon in den ersten zwölf Monaten erste Führungskräfte oder Vertriebsmitarbeiter ein, war ihre Wahrscheinlichkeit zu scheitern um 20 bis 40 Prozent größer als bei Start-ups, die sich mehr Zeit ließen.

