Wenn sich Firmen um die Fruchtbarkeit ihrer Angestellten sorgen
In der Schweiz haben erste Firmen das Einfrieren von Eizellen ihrer Angestellten bezahlt. Was steckt dahinter?
Alison ist 35 Jahre alt. Bei der ausgebildeten Anästhesieärztin stand bisher die Karriere im Fokus: Auf das Studium folgten die strengen Jahre als Assistenz, und nach ihrem Abschluss erfolgte der eigentliche Schritt in die Arbeitswelt, wo sie die essenzielle Erfahrung im Operationssaal sammelte. Doch während die Anzahl der Arbeitsjahre anstieg, tickte auch die biologische Uhr. Und zwar immer lauter.
Da Alison seit ihrer Ausbildung auf die Karriere fokussierte, rückte die Familienplanung in den Hintergrund. Einen Mann an ihrer Seite gab es nicht – die Zeit liess es nicht zu. Ein Kinderwunsch ist aber vorhanden, trotz fortschreitendem Alter. Nur: Ab dem Alter von 35 Jahren öffnet sich bei der Frau eine Schere. Einerseits nimmt die Qualität der noch vorhandenen weiblichen Eizellen rapide ab. Anderseits steigt die Gefahr einer Risikoschwangerschaft stark an.
Heute gibt es jedoch Wege, das biologische Ticken zu umgehen. Einen davon nutzte Alison: Solange sie noch gesunde Eizellen hat, friert sie diese ein – zur Absicherung. «Social Freezing» nennt sich der Vorgang, Kostenpunkt je nach Höhe und Anzahl der Behandlungen: bis zu 10’000 Franken.
Firmen bezahlen den Eingriff
Alison berappte die Entnahme aus eigener Tasche. Diese finanziellen Mittel stehen aber nicht allen zur Verfügung. Und das bringt heute – zur Verwunderung vieler – den Arbeitgeber auf den Plan. In den USA zahlen Firmen wie Apple, Meta oder Peloton bei Fruchtbarkeitsbehandlungen mit – kräftig sogar. Bis zu 20’000 Dollar übernimmt der Arbeitgeber, wenn die Angestellten Eizellen einfrieren lassen wollen.
Jetzt überquert das Thema den Atlantik und erreicht die Schweiz. Ende Oktober gab hierzulande die erste Firma offiziell bekannt, Fruchtbarkeitsbehandlungen ihrer Angestellten finanziell zu unterstützen. Es ist das Pharmaunternehmen Merck, das unter anderem selber Fruchtbarkeitsprodukte herstellt.
Eine Marketingaktion also? Nein, sagt der Direktor von Merck Schweiz, Florian Schick: «Merck kennt das Thema zwar seit 1906 – wir sind sozusagen Pionier der ersten Stunde –, aber die Initiative kam von unseren Mitarbeitenden.» Diese wurden aufgefordert, Ideen zu präsentieren, was Merck als moderner Arbeitgeber bieten könnte. Nach einer Prüfung setzte das international tätige Unternehmen den Vorschlag in diversen europäischen Ländern um.
Die Unterstützung der Schweizer Niederlassung beläuft sich auf einen «fünfstelligen Betrag», der die Kosten von Tests über Voruntersuchungen in der Klinik für Männer und Frauen bis hin zu den gesamten Behandlungen umfasst. Eine genaue Kostenschätzung zu geben, sei schwierig, da diese je nach Land, Person, Aufwand und Anzahl benötigter Behandlungen verschieden seien. Der Betrag stehe aber allen Mitarbeitenden ab dem ersten Tag zur Verfügung – ohne Einschränkung hinsichtlich sexueller Orientierung, Geschlecht oder Art der Behandlung.
Sichern Sie sich jetzt das Digital-Abo für die Handelszeitung zum exklusiven Vorteilspreis!
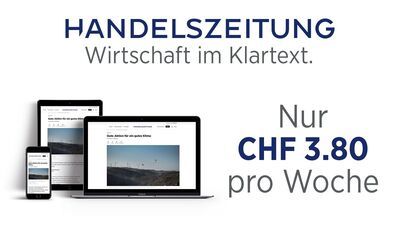
Ethische Vertretbarkeit
Auf Nachfrage, ob es als Firma ethisch vertretbar sei, in die Familienplanung ihrer Angestellten einzuwirken, winkt Schick ab: Sie würden nicht direkt Einfluss nehmen, sondern nur unterstützen. «Wir alle haben Freunde, bei denen es nicht klappt. Statistisch gesehen ist das bei einem von fünf Paaren der Fall. Das ist eine psychische Belastung bei einem sowieso schon emotionalen Thema. Und dazu kommt die finanzielle Belastung», so der Geschäftsführer von Merck Schweiz. «Genau da wollen wir Raum schaffen für Familien- und Karriereplanung und das Thema ansatzweise enttabuisieren.»
Aus ethischer Perspektive wird das kritischer gesehen: Tragen die Firmen für Mitarbeitende die Kosten für Social Freezing, werde die Belegschaft die Erwartungshaltung entwickeln, dass die Karriere der Mutterschaft vorgezogen werden muss, lautet die Kritik. «Es geht bei der Frage nach Reproduktion und Kinderwunsch um etwas sehr Persönliches. Das sollte nicht vermischt werden mit der Frage, welche Anreize der Arbeitgeber bietet», sagte Markus Zimmermann, Vizepräsident der Nationalen Ethikkommission (NEK) im Bereich der Humanmedizin, gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.
Auch der Wirtschaftsethiker der Universität St. Gallen, Thomas Beschorner, äussert sich gegenüber Social Freezing kritisch: «Wir betrachten Social Freezing als freie Entscheidung jeder einzelnen Frau. Wenn Unternehmen hier jedoch mitreden, ist das bedenklich.» Für ihn sind zwei Gründe ausschlaggebend: Erstens sei auch nach einem Social Freezing kein Garant für Kinder vorhanden. Mit Social Freezing würden Firmen aber eine biologische Absicherung und damit den Deal «Erst die Karriere, dann das Kind» anbieten. Das sei eine Illusion.
Zweitens stellt sich für Beschorner die Frage, inwieweit sich ein Arbeitgeber in einen solch intimen Bereich wie Sexualität, Fortpflanzung und Familienplanung einmischen soll. Dem hält der Schweizer Merck-Direktor entgegen: «Hierzulande ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf vermehrt schwieriger aneinander vorbeizubringen – sei es aus organisatorischen Gründen im Rahmen der Kinderbetreuung, wegen sich verändernden Lebensmodellen, aufgrund der Tabuisierung des Themas oder finanziell bedingt.» Viele würden das Thema Familie deshalb – auch bewusst – nach hinten schieben, weil es der Karriere schaden könne. Dabei sei es im Interesse von Merck, Paare in ihrer Familienplanung zu unterstützen.
«Als Firma haben wir nun für Fertilität Raum geschaffen, wir mischen uns aber keineswegs in diese ein. Niemand in der Firma weiss, wer das Angebot nutzt, es ist ein anonymer Prozess», erklärt Schick. Sein Fazit zur Umsetzung der finanziellen Unterstützung: «Das Angebot stösst unter den Angestellten auf grossen Zuspruch.»
Interesse an Social Freezing steigt
In der Schweiz lassen immer mehr Frauen ihre Eizellen einfrieren. Dabei wird zwischen sozialem und medizinischem Einfrieren unterschieden. Ein Grund für das medizinische Einfrieren können Krankheiten wie Krebs oder Endometriose sein, welche die Reproduktion gefährden. In diesen Fällen trägt die Krankenkasse die Kosten. Werden Eizellen jedoch aus «sozialen» Interessen eingefroren, müssen die Kosten aus der eigenen Tasche bezahlt werden.
Das nehmen einige in Kauf, denn das Interesse an Social Freezing steigt, wie Julia Schmid, Psychologin und Forscherin zum Thema an der Universität Zürich, weiss. Aktuell analysiert sie die Studienergebnisse des gross angelegten Forschungsprojekts «EEggg». Sie könne zwar noch keine Ergebnisse mitteilen, eine Beobachtung habe sie aber bereits gemacht: «Frühere Studien aus dem deutschsprachigen Raum führten zum Ergebnis, dass sich ein Grossteil der Frauen Social Freezing nicht vorstellen kann. In unserer Stichprobe ist es genau umgekehrt.»
Wieso das so ist, führt sie darauf zurück, dass an ihrer Studie vor allem junge, gebildete und am Thema interessierte Frauen teilgenommen haben: «Mit einem höheren Bildungsgrad steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man sich das Einfrieren vorstellen kann.» Damit einher gehe ein höheres Gesundheitsbewusstsein sowie das Wissen über die eigene Fertilität. Mit zunehmendem Wissen zur eigenen Fertilität wächst vermutlich in dieser Gesellschaftsgruppe auch das Interesse am Einfrieren von Eizellen. Konkret heisst das: Im Jahr 2020 waren aus sozialen Gründen Eizellen von 1055 Frauen eingefroren. Im Folgejahr erhöhte sich die Zahl laut dem Bundesamt für Gesundheit bereits auf 1574. Der Anstieg liegt also bei etwa einem Drittel. Neuere Daten sind noch nicht bekannt.
Im öffentlichen Diskurs wird Social Freezing laut Schmid aber auch ein Stück weit «romantisiert»: Die Risiken sowie der Aufwand gehen oft im Hype unter. «Social Freezing allein ist ein aufwendiger Prozess. Das macht jemand nicht einfach so – ob die Firma bezahlt oder nicht, hat vermutlich einen geringen Einfluss», so Schmid. «Vor allem hinter einer anschliessenden künstlichen Befruchtung steckt so viel mehr – körperlich, emotional und finanziell.» So nutzt nur eine Minderheit der Frauen ihre eingefrorenen Eizellen für eine künstliche Befruchtung – die klappen kann oder auch nicht. «Das Einfrieren von Eizellen ist oft hauptsächlich eine Absicherung», so Schmid.
Dass nur eine Minderheit die eingefrorenen Eizellen am Ende auch tatsächlich nutzt, zeigt, dass Social Freezing weit davon entfernt ist, der Hauptträger der Familienplanung zu sein. «Es kann aber den Druck etwas wegnehmen.» Genauso ist es auch bei Alison. Sie hat mittlerweile über eine Dating-Plattform jemanden kennengelernt. Jüngst kam die Nachricht, dass sie offiziell liiert ist. Bezüglich des Kinderwunsches hat sie aber noch keine Aussagen gemacht – für den Fall der Fälle schlummern jedoch gesunde Eizellen in einer Klinik, die Alison eine Ruhe geben, die sie sonst nicht hätte.
Unsere Abos finden Sie hier: https://fal.cn/Xing_HZ_Abo
Mit dem Digital-Abo von Handelszeitung und BILANZ werden Sie umfassend und kompetent über alle relevanten Aspekte der Schweizer Wirtschaft informiert
Weitere News aus Wirtschaft, Politik und Finanzen finden Sie hier: https://fal.cn/Xing_HZ_Home

