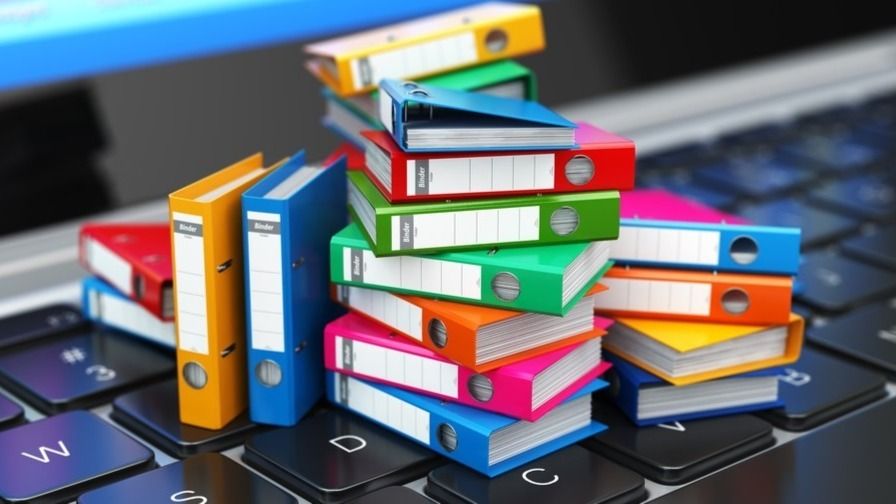Wie Bürokratie die Unternehmen lähmt – und was dagegen zu tun ist
Je schwerfälliger eine Organisation, desto anfälliger ist sie für Überholmanöver. Eine Transformation in einen fluideren Zustand ist geradezu zwingend.
Kaum zu glauben, doch es ist tatsächlich passiert. Das Glühbirnendrama. In einem Facility-Management-Unternehmen. Ein dort tätiger Hausmeister hatte sich unverfroren erdreistet, bei einem Kunden eine Glühbirne auszuwechseln, ohne sie in Rechnung zu stellen. Das kann man natürlich nicht durchgehen lassen. Also wurde ein Prozess aufgesetzt. Von nun an mussten alle ein Formular ausfüllen, das wurde eingereicht, geprüft und genehmigt.
Erst dann bekamen die Kunden einen Auswechseltermin. Was der ganze Vorgang – im Vergleich zum Einkaufspreis einer Glühbirne – gekostet hat, wurde nicht kalkuliert. Das Schlimmste aber aus Hausmeistersicht: Früher bekamen sie von den Damen in den Büros oft ein Lächeln für ihre Arbeit. Jetzt rollten diese nur noch verständnislos mit den Augen.
Ein Einzelfall? Erst kürzlich hatte ich es mit einer Firma zu tun, da brauchte die Bestellung einer Computermaus ein Formular und zwei Unterschriften. Das haben wir mal durchgerechnet: Der Vorgang hat – bei 10 Euro für die Maus – Transaktionskosten von 200 Euro produziert. Hinzu kamen Opportunitätskosten von 100.000 Euro. Denn der neue junge Mitarbeiter, dem das passierte, hat schleunigst die Flucht ergriffen. So zu arbeiten kam für ihn nicht infrage.
Chefs, die ihre Zeit mit Häkchenmachen verplempern
Top-Talente wollen sich nicht infantilisieren und von „disziplinarischen Vorgesetzten“ (was für ein Unwort) mit „Entscheidungsgewalt“ (noch so ein Unwort) bevormunden lassen. Zumal das „Absegnen“ (auch ein Unwort, sind Führungskräfte denn Götter?) meist reine Formsache ist. Solche Vorgaben machen Führungskräfte, die das oft gar nicht wollen, zu Edelsachbearbeitern, die ihre Zeit mit Häkchenmachen verplempern.
„Da muss ich erst den Chef fragen“, das höre ich ständig. So gewöhnt man den Mitarbeitenden ab, Verantwortung zu übernehmen. Kein Wunder, dass damit die Eigenständigkeit schwindet, so wie ein Muskel verkümmert, weil man ihn nicht benutzt. Wer Mitarbeitende dafür belohnt, dass sie vordefinierten Prozessen folgen, bekommt Leute, die Vorlagen ausmalen können, aber niemanden, der eigene Bilder entwirft.
In alphahierarchischen Silo-Organisationen ist Monsterbürokratie besonders verbreitet. Solcher Aktionismus unterstreicht die eigene Wichtigkeit und sichert die Stellung. Auch wenn man damit wertvolle Zeit verprasst, Fortschritt verhindert und womöglich die Nachbarabteilungen ausbremst? Egal! Denn leider wird man nicht für Kollaboration bonifiziert, sondern für das Erreichen der Silo-Ziele. Und Menschen tun das, wofür man sie belohnt.
Viele Unternehmen sind reinste Verwaltungsmonster
Auf dem Weg in die Zukunft brauchen die Unternehmen sowohl helle Köpfe als auch leichtes Gepäck, weil die Märkte, wie die Hasen, immer neue Haken schlagen. Für Administrationsfirlefanz, Reporting-Exzesse, aufwendige Abstimmungsschleifen, mehrstufige Freigabeprozesse, Kompetenzgerangel und Irrläufe im Vorschriftengeflecht hat niemand noch länger Zeit. Regeln, Standards und Normen von früher lähmen das Vorankommen, frustrieren die Mitarbeitenden und verärgern die Kunden.
Viele Unternehmen sind reinste Verwaltungsmonster. Dort haben sich über die Jahre Unmengen von Routinen und Regularien aufgetürmt, die natürlich auch kontrolliert werden müssen. Doch mit Kontrolle investiert man in die Vergangenheit – und nicht in die Zukunft. Kontrollen haben nur im Blick, was sie kontrollieren, Kennzahlen nur das, was sie messen, anderes, wichtigeres, zukunftsförderliches jedoch nicht. Und je schwerfälliger eine Organisation, desto anfälliger ist sie für Überholmanöver.
Kontrolle gebiert zudem immer noch mehr Kontrolle. So wird sie zum Totengräber für Innovationen. Schlimmer noch: Vorgaben zu folgen, führt zu „erlernter Hilflosigkeit“ (Martin E. Seligman). Selbstwirksamkeit geht verloren, das Engagement sinkt, die Menschen stumpfen ab und haben Angst, Neues zu wagen. Leistungserosion ist die Folge, weil jeder nur noch nach Vorgaben tanzt und niemand sich noch was traut. Das macht Unternehmen lahm und dumm.
Mammutbürokratie muss ein Preisschild bekommen
Ausufernde Verfahrensweisen und Vorschriftenberge stellen sich gar nicht so selten als Selbsterhaltungsmechanismen heraus. Sie untermauern Wichtigkeit, sichern Pfründe und dienen der Bedeutungserhöhung. Durch einen Verwaltungsapparat, der letztlich vom Kunden bezahlt werden muss, und eine aufgeblähte Vorgaben- und Steuerungsadministration schaffen sich viele Bereiche überhaupt erst eine Existenzberechtigung. So sind auch Reportings und Kennzahlen zu hinterfragen. Welche davon werden wirklich gebraucht – und wozu ganz genau? Vieles ist von keinerlei Nutzen, erzeugt keine Wertschöpfung und ist somit pure Verschwendung.
Mit Gegenwehr ist wohl zu rechnen. Rückbau birgt die Gefahr des Besitzstandsverlusts. Das Mehr ist immer ein Zeichen von Geltung und Macht. Neulich war ich schier sprachlos. „Wir bauen hier keine Bürokratie ab. In meinem Bereich bringt das rein gar nichts“, erklärte mir ein Abteilungsleiter. Er sah sich als die wichtigste Führungskraft im Unternehmen, weil er die höchste Mitarbeiterzahl aller Abteilungen hatte. Diese Stellung wollte er nicht verlieren. Unter den fadenscheinigsten Gründen widersetzte er sich jeder Digitalisierung. Seine Leute hantierten weiter mit Excel-Sheets.
Oft wissen „die da oben“ auch gar nicht, welchen Uralt-Prozessen die Belegschaft immer noch folgt. In einem Fall gab es aus früheren Zeiten einen sogenannten Business-Knigge, ein Pamphlet mit Regeln, Richtlinien, Standards und Normen. Die neue CEO, die das Unternehmen in Richtung Selbstorganisation entwickeln wollte und den Mitarbeitenden zunehmend Freiräume gab, wunderte sich, wie schleppend alles voranging. Niemand hatte ihr von der Existenz dieses „Gesetzbuchs“ erzählt. Erst, als sie es ausdrücklich verboten hatte, lief der Bürokratieabbau wie am Schnürchen.
Regeln von gestern passen schon morgen nicht mehr
Regeln ordnen zwar Chaos. Sie verhindern aber auch Alternativen. Das ist der Preis, den man zahlen muss, wenn man Regeln implementiert. Oft werden sie aus purer Gewohnheit beibehalten und gar nicht erst hinterfragt. Oder sie kommen nicht auf den Prüfstand, obwohl sie längst veraltet sind. Hier ein paar klassische Statements:
„Das haben wir immer schon so gemacht.“ >> Man weiß nicht mal mehr, wer das einst eingeführt hat, doch niemand macht sich über ein Update Gedanken.
„Die Revision will das so.“ >> Nein, das stimmt nicht! Es handelt sich um eine reine Vermutung, man hat die Revision nicht einmal explizit dazu befragt.
„Das lassen unsere Compliance-Regeln nicht zu“. >> Da ist jemand übervorsichtig oder zu bequem und schiebt ein Regelwerk vor, das so nicht existiert.
„Darüber braucht man mit dem Chef gar nicht reden.“ >> Auch das ist eine Fehleinschätzung, die aus Unterwürfigkeit, Angst oder Mangel an Mut entsteht.
Natürlich stellen wir Leitplanken auf, damit niemand in den Abgrund gerät. Das bedeutet aber doch nicht, dass alles bürokratisch festgezurrt werden muss. Durch bedachtes Ausmisten kann man übrigens nicht nur Zeit, sondern auch eine Menge Kosten sparen. So kam bei einer Versicherungsgesellschaft heraus, dass von den 120 existierenden Broschüren lediglich 18 in der täglichen Arbeit der Makler eingesetzt wurden. Da fragt man sich: Wie kann es überhaupt zu solchen Auswüchsen kommen?
Bürokratieabbau durch „Minus50“ und „2 out 1 in“
Um Zeit und Raum für Neues, die Zukunft und den Fortschritt zu schaffen, müssen zunächst die Altlasten weg. Das bekannte „1 in - 1 out“-Prinzip reicht dafür nicht. Es besagt, dass vor jeder neuen Verfahrensweise zunächst eine alte entsorgt werden soll. Doch das ist zu wenig. Die Anzahl der Formalprozesse und die insgesamte Bürokratiefülle blieben in Summe gleich. Eine „2 out - 1 in“-Lösung ist nötig, damit kräftig entrümpelt werden kann.
Eine andere Variante nenne ich „Minus50“, Das bedeutet: 50 Prozent weniger Administration, Regelwerke, Statusberichte, Formulare, Genehmigungsverfahren und so fort. Hiermit sind in diesem Fall nicht die gesetzlichen Regularien und behördlichen Vorschriften gemeint, sondern überholte hausinterne Unternehmensroutinen. Ganz ohne Strukturen geht es natürlich nicht, allein deshalb ist „Minus50“ vernünftig.
Einleuchtende Funktionsvorgaben sichern ein notwendiges qualitatives Leistungsniveau. Und sie helfen, böse Fehler zu vermeiden. Solche Prozesse sind kluge Prozesse. Dumme Prozesse hingegen verplempern nur wertvolle Zeit. Zudem sorgt Bürokratie für Selbstvermehrung. Jeder Ausrutscher hat eine weitere Regel zur Folge. Die Krönung, auch schon erlebt, sind Regeln über den Umgang mit Regeln.
Die Quick-win-Variante lautet: „Kill a stupid rule“
„Kill a stupid rule“ wurde ursprünglich von US-Banker Vernon Hill entwickelt. Ihm ging es speziell darum, Vorschriften auszumachen und abzuschaffen, die kunden- unfreundlich waren. Eine ideale „Kill a stupid rule“-Ausgangsfrage ist diese:
„Kill a stupid rule!“ Von welchen untauglichen Standards, Regeln und Normen und von welchem administrativen Unsinn sollten wir uns schnellstmöglich trennen?
Bittet im Rahmen eines Kreativmeetings oder Workshops die Anwesenden, innerhalb von zehn Minuten so viele „stupid rules“ wie nur möglich zu finden, auf Post-its zu schreiben und an eine Pinnwand zu heften. Hiernach wird gemeinsam priorisiert. Dazu erhält jeder drei verschiedenfarbige Klebepunkte: rot ist Prio 1 und entspricht drei Punkten, grün ist Prio 2 und entspricht zwei Punkten, blau ist Prio 3 und entspricht einem Punkt. So ermittelt ihr die Top-Prios der gesamten Gruppe. Hiernach stellt ihr folgende fokussierende Frage:
Was ist die cleverste Idee, wie wir es stattdessen besser machen können?
Diese Frage muss exakt so gestellt sein, weil sonst oft nur Allerweltideen kommen. Aus meiner Erfahrung heraus kann ich sagen: Die Leute werden meist unglaublich schnell fündig. Sehr oft wissen sie längst, was wie optimiert werden kann und muss. In kleinen Arbeitsgruppen wird eine bestmögliche Lösung erarbeitet – und zunächst testweise umgesetzt. Nach der Testphase wird sie dann übernommen, überarbeitet oder verworfen, um nach einer noch besseren Lösung zu suchen.
Wie hilfreich „Kill a stupid rule“ ist, stelle ich beinahe in jedem Workshop fest. Einmal ging es um ein firmeninternes Bestellprogramm. „Lassen Sie uns das doch mal auf den Prüfstand stellen“, sag ich. „Nicht nötig“, so der Chef, „ist bestens akzeptiert und läuft prima.“ Wir haben es dann doch gemacht. Und siehe da: Alle Teilnehmenden hielten es für völlig veraltet. Zugleich hatten sie jede Menge Optimierungsvorschläge parat.
Zum Schluss noch ein Extratipp: Um die volle Energie auf das Neue zu lenken, kann es sinnvoll sein, sich von abgewählten Vorgehensweisen achtsam zu trennen. Die hatten ja auch mal ihr Gutes. Dem trauert wer hinterher. Deshalb gilt es, Verfahren, von denen man Abschied nimmt oder Konzepte, die eingestampft werden müssen, mit einem Abschiedsritual in Würde zu Grabe zu tragen, damit sich jeder von ihnen lösen kann.
_________________
Dies sind Ausschnitte aus meinem neuen Buch „Zukunft meistern“. Es ist #1 der Frühjahrsneuvorstellungen von ChangeX: „Furios führt das Buch die entscheidenden Zukunftsthemen zusammen, wohldurchdacht und mit klarem Praxisbezug.“