„Autonomes Fahren in Deutschland droht zu sterben“: Bosch streicht Tausende Stellen
Einst wollten die deutschen Hersteller Milliarden mit autonomen Fahrzeugen verdienen. Jetzt streicht Bosch Ingenieursstellen. Mehr als assistiertes Fahren ist nicht drin.
Am späten Abend des Totensonntags versammeln sich in Leonberg bei Stuttgart dutzende Männer und Frauen vor den Werkstoren von Bosch. Sie entzünden Fackeln und halten Plakate in die Kamera, um ihrem Ärger Luft zu machen, wie sie auf der Internetseite der IG Metall berichten. Vor wenigen Tagen hat ihr Arbeitgeber Bosch entschieden, nochmals 3500 Stellen einzusparen. Leonberg trifft es am stärksten.
In den letzten fünf Jahren wurden hier 1500 neue Softwareentwickler eingestellt, jetzt werden die Stellen wieder abgebaut. Schon im Frühjahr verkündete der Konzern eine Kürzung von 1200 Jobs im Geschäftsbereich Cross-Domain Computing Solutions, kurz XC, dem Bereich für Softwarelösungen in der Mobilität. Jetzt kommen 1800 weitere dazu.
Klar, die Sparte Mobility leidet an der Absatzlücke. Das Management will nicht vollends an der anvisierten Marge von sieben Prozent vorbeischrammen, intern rechnet man schon jetzt nur noch mit knapp der Hälfte. Überraschend kommt es dennoch, dass der stärkste Einschnitt ausgerechnet jenen Bereich betrifft, der sich eigentlich um eines der größten Zukunftsfelder des Konzerns kümmern wollte.
In Leonberg, so war lange die Idee, sollte das Zentrum für autonomes Fahren entstehen. Einst wurden hier große Baugruben ausgehoben für Labore im „Silicon Valley der Fahrerassistenz“, wie die Metaller auf ihrer Internetseite schreiben. Wie es nach den Einschnitten um den Bereich steht? Schwierig, um es vorsichtig zu sagen. Die Baugruben seien wieder zugeschüttet. Die Arbeitnehmerseite befürchtet eine Zäsur, nicht nur für Bosch, sondern für das autonome Fahren in Deutschland insgesamt.
„Wenn es wirklich so kommen sollte, dass Bosch die Entwicklung derart massiv zurückfährt“, sagt Adrian Hermes, Konzernbeauftragter der IG Metall für Bosch, „dann droht das autonome Fahren in Deutschland zu sterben.“
Starke Worte sind das. Aber treffen sie auch zu? Wie schlägt sich Bosch, schlägt sich Deutschland bei der vermeintlichen Zukunftstechnologie Nummer eins wirklich?
👉 Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen
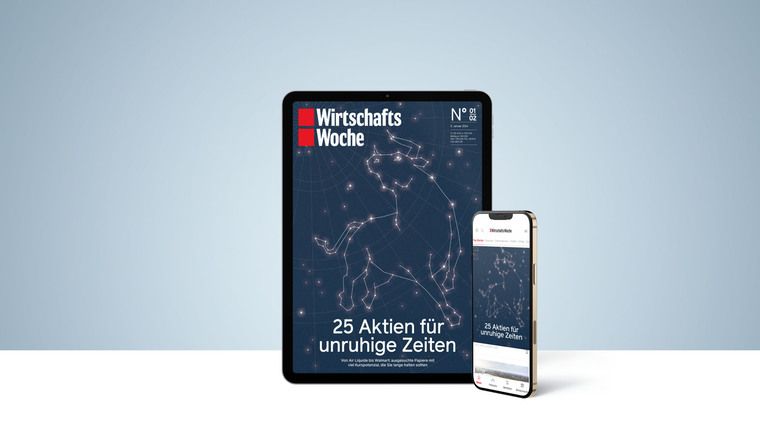
Nächster Versuch: Generative KI
Die Frage treibt selbst Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier um. Anfang der vergangenen Woche, das Staatsoberhaupt ist ins Bosch-Entwicklungszentrum nach Renningen bei Stuttgart gereist. Die Hand am Kinn gestützt, blickt er auf einen mit Kameras und Sensoren umgebauten Audi und lauscht Konzernchef Stefan Hartung. Der erklärt Boschs Fortschritte beim autonomen Fahren.
Ein Schwerpunkt: Die Krux des Alltags im Straßenverkehr. Wie soll sich etwa das Fahrzeug verhalten, wenn plötzlich ein Ball auf die Straße rollt? Für Menschen ist die Sache klar. Maschinen aber verzweifeln dran, schließlich könne man sie aufgrund der wenigen Vorfälle kaum trainieren. Bosch setzt deshalb auf eine generative Künstliche Intelligenz. Eine Software liest eine Vielzahl von Texten im Internet und lernt die Zusammenhänge: Wo ein Ball, da ist ein Kind möglicherweise nicht weit. Rollt ein Ball auf die Straße, bremst das Auto vorzeitig. Das habe Bosch in den „letzten ein, zwei Jahren neu entwickelt“, sagt Hartung und Steinmeier nickt beeindruckt.
11.000 Patente und Patentanmeldungen halte das Unternehmen aktuell weltweit im Bereich der Fahrerassistenz und des autonomen Fahrens, heißt es von Bosch, auch im Jahr 2024 gehöre das Unternehmen „zu den aktivsten Patentanmeldern“. Von einem Rückzug keine Spur, so die Botschaft. Man sei „unverändert“ und „mit Nachdruck“ am Thema dran, verfolge weltweit knapp 300 Kundenprojekte für die Entwicklung von Hard- und Softwarelösungen. Beeindruckende Zahlen sind das, aber sie sind schwer in Relation zu bringen zu jenem großen Ziel, dass sich das Unternehmen gesetzt hat: ein Autosystem, das Passagiere ohne menschliche Eingriffe auf freigegebenen Strecken (Level 4) oder auf allen Straßen (Level 5) zum Ziel bringt.
Um das zu erreichen, wähnten sich die drei großen deutschen Zulieferer Bosch, ZF und Continental lange in einer ausgesprochen vorteilhaften Lage. Als nur eine Handvoll Hersteller auf der Welt beherrschten sie praktisch die gesamte Kette an Bauteilen, die dabei beteiligt sind: Antrieb, Lenkung, Bremsen, Sensorik und Software. Noch vor einigen Jahren wirkte es daher für viele wie eine Frage der Zeit, bis die technischen Hürden auf dem Weg zum Level 5 wie Dominosteine purzeln würden. Doch die Technologie mit sehr hohen Sicherheitsanforderungen ist verflixter als gedacht. Ein Gewinngeschäft – kaum in Sicht.
Viele Projekte „aufgegeben“
Die erste Sparwellen im Softwarebereich XC begründete Bosch im Frühjahr mit „Verzögerungen“ beim autonomen Fahren. Und auch jetzt erklärte Hartung gegenüber der „Automobilwoche“ den Kurs damit, dass sich die Nachfrage nach Fahrerassistenzsystemen und Lösungen zum automatisierten Fahren „nicht so wie prognostiziert“ entwickele. „Viele Projekte“ würden von den Autobauern „zurückgestellt oder aufgegeben“. Die Lage im Softwarebereich sei Hartung zufolge „deutlich angespannter als noch vor ein paar Monaten“.
Das Unternehmen ist mit seinem Rückzug nicht allein. Sukzessive sind ZF und Continental zuletzt aus verschiedenen Produkten ausgestiegen. Sei es in der Erwartung, dass sich die Entwicklung von Sensorsystemen wie dem Lidar rentierten, weil sie bald eine Art billige Alltagsware werden dürften. Sei es, weil im Bereich der Chips und Software so mancher chinesische und amerikanische Wettbewerber schlicht über mehr Geld verfügt.
Immense Kosten
Die Kosten, um die Entwicklung voranzutreiben, sind immens. Allein für Sensoren, hochauflösende Kameras, Radar und die „Lidar“-Technologie, bei der Laser zur Erzeugung von 3D-Bildern eingesetzt werden, werden pro Testfahrzeug zehntausende Euro fällig, Montage und Datenverarbeitung nicht einmal mit eingerechnet. Trotz Millionen von Kilometern, die autonome Flotten von Waymo in San Francisco oder die Robotaxis von Appolo Go in Peking zurücklegen, rechnen Experten vorerst nicht mit Serienfahrzeugen für den Individualverkehr.
„Noch heute gibt es keinen einzigen Hersteller auf der Welt, der Pkw mit Level 4 vertreibt oder dies in den nächsten fünf Jahren tun wird“, sagt ein Brancheninsider, der für Mercedes am autonomen Fahren arbeitet. Im Februar verkündete selbst Apple, das finanziell so weich gepolsterte Unternehmen, den Ausstieg aus „Project Titan“. Apple galt lange als einer der Vorreiter, konnte aber die Probleme im Straßenverkehr nicht in den Griff bekommen. Das ruinöse Geschäft wurde zu viel.
Auch deshalb konzentrieren sich die deutschen Hersteller seit geraumer Zeit auf assistiertes Fahren bis Level 3. Und da sieht es auch im internationalen Vergleich bislang ganz gut aus. Mercedes bietet in seiner S-Klasse einen Autopiloten, mit dem man auf der Autobahn bis 95 Stundenkilometern die Hände vom Lenkrad nehmen kann. In Peking wagt das Unternehmen demnächst gar als erster Hersteller Testfahrten im Level 4. Auch BMW ist davon nicht weit entfernt, will etwa produzierte Fahrzeuge in seinen Fabriken in bayerischen Dingolfing selbst zur Kontrolle fahren lassen. Volkswagen plant ab dem nächsten Jahr eine kleine Shuttle-Flotte von 25 Moia-Autos durch Hamburg fahren zu lassen.
„Bis Level 3 halten die Deutschen gut mit, danach wird es dünn“, sagt der Mercedes-Insider. Amerikanische und chinesische Anbieter seien vorne und blieben es auch.
👉 Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen
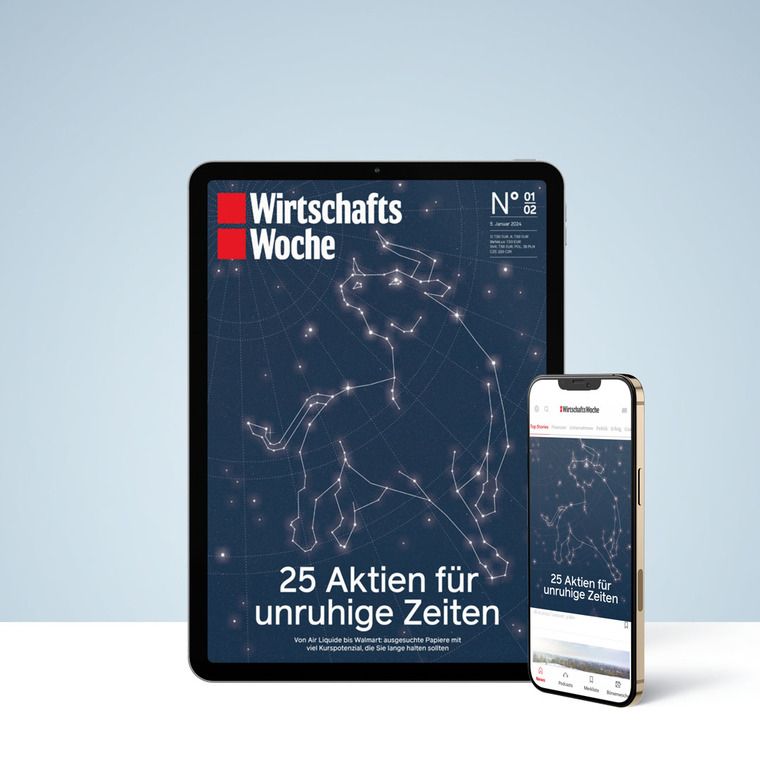
👉 Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen

