Das Profil der Bürorückkehrer: Jung und männlich
Längst nicht alle Mitarbeitenden drängt es zurück ins Büro. Dadurch könnte in Zukunft eine Zweiklassengesellschaft entstehen.
Wer in Zukunft ein Büro betritt, wird vor allem junge Gesichter sehen. Im Aufzug, an den Schreibtischen, in der Kantine – überall Menschen, die am Anfang ihres Berufslebens stehen. Die meisten von ihnen sind Männer. Frauen dagegen tauchen in der Bürowelt deutlich seltener auf – und ältere Personen überhaupt nicht.
Vor diesem Szenario warnt Hung Lee, ein bekannter britischer Personalexperte. «Das hybride Arbeiten führt zu einer Trennung der Geschlechter und Generationen», sagt der CEO der Rekrutierungsplattform Workshape.
Lee befürchtet, dass sich Frauen und Ältere dauerhaft ins Heimbüro zurückziehen und die Präsenzwelt den jungen Männern überlassen. In der HR-Szene finden seine Thesen durchaus Zustimmung. Aber bringt das hybride Arbeiten wirklich die alte Männerwirtschaft zurück? Und wie können Heimarbeiterinnen und -arbeiter verhindern, abgehängt zu werden?
Sichern Sie sich jetzt das Digital-Abo für die Handelszeitung zum exklusiven Vorteilspreis!
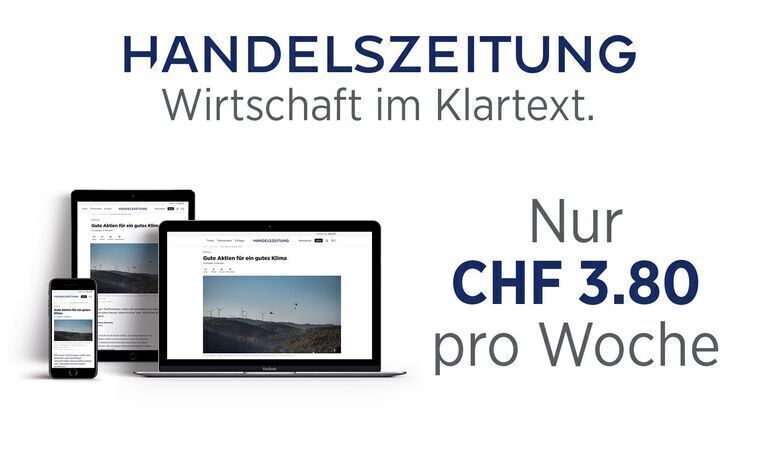
Der Bürorückkehrer ist jung, die Homeoffice-Nutzerin älter
Dass in Zukunft mehr zu Hause gearbeitet wird, scheint sicher. Der Corona-Effekt ist hier permanent. In einer aktuellen Umfrage von Microsoft sagten 37 Prozent der Schweizer Angestellten, sie dächten darüber nach, in den kommenden zwölf Monaten mit dem ortsunabhängigen Arbeiten anzufangen.
Allerdings begeistern sich nicht alle Erwerbstätigen gleichermassen für die Heimarbeit. Zwischen den Generationen öffnet sich ein Graben – und es sind keineswegs die jungen Digital Natives, die sich nach Kollaboration via Bildschirm sehnen.
«Der typische Homeoffice-Nutzende ist älter, überwiegend gut qualifiziert und arbeitet in einer mittleren Position», sagt Hartmut Schulze, Professor für angewandte Psychologie an der Fachhochschule Nordwestschweiz.
Ältere haben ein bestehendes Netzwerk und eine genügend grosse Immobilie
Dass die Älteren gerne daheim arbeiten, hat einen simplen Grund: Sie brauchen das Büro nicht. Sie müssen keine neuen Kontakte knüpfen, da sie nach vielen Berufsjahren schon über ein gutes Netzwerk verfügen. Sie sind in der Regel verheiratet und brauchen das Büro nicht als Partnerschaftsbörse (ein Drittel aller Paare lernt sich dort kennen). Zudem wohnen ältere Arbeitnehmende oft in einer grossen Immobilie und haben Platz – ein wichtiger Faktor.
«Wer ein eigenes Arbeitszimmer hat, kann seine Privatsphäre regulieren, seine Aufgaben am Stück erledigen und schläft sogar besser», berichtet Wissenschafter Schulze, der seit Jahren die Arbeit im Homeoffice untersucht. Berufseinsteiger dagegen mussten während der Pandemie mitunter am WG-Tisch ihren Laptop aufklappen.
Kein Wunder also, dass den Jungen der grosse Schreibtisch in der Firmenzentrale attraktiv erscheint. Als die Arbeitgeber-Bewertungsplattform Glassdoor unlängst deutsche Angestellte fragte: «Freuen Sie sich auf die Rückkehr ins Büro?», bejahten das 44 Prozent der 18- bis 24-Jährigen. In der Altersklasse von 45 bis 54 fiebern nur 19 Prozent der Rückkehr ins Büro entgegen. Auch die Begeisterung für komplette Heimarbeit fällt je nach Altersklasse unterschiedlich aus. Jeder fünfte alte Hase kann sich vorstellen, auf 100 Prozent remote umzusteigen. Bei den Jungen ist es nur jeder Zehnte.
Eine Zweiklassengesellschaft entsteht, da die Mütter zu Hause bleiben
Eine Gruppe dürfte im Büro bald kaum noch auftauchen: Mütter. Denn Frauen mit Kindern entscheiden sich überdurchschnittlich oft für Remote Work. 57 Prozent der berufstätigen Mütter wollen in Zukunft nur noch zeitweise ins Büro kommen, bei den Vätern sind es 48 Prozent. Das ergab die weltweite Umfrage «Future Forum Pulse».
Dass Frauen das Homeoffice mehr schätzen als Männer, ist an sich nichts Neues, durch Corona hat sich der Trend jedoch verschärft: 82 Prozent aller berufstätigen Mütter wollen laut «Future Forum Pulse» künftig ihren Arbeitsort frei wählen – so viele wie noch nie. Die ersten Unternehmen denken schon darüber nach, den Betriebskindergarten wieder zu schliessen, weil sie erwarten, dass in Zukunft kaum noch Mütter ins Büro kommen.
Herber Rückschlag für Diversity-Initiativen
Am Ende dieser Entwicklung könnte eine Bürowelt stehen, die von Männern dominiert wird – und aus der graue Haare verschwinden. Nach vielen Jahren der Diversity-Initiativen wäre das ein herber Rückschlag. «Eine solche Zweiklassengesellschaft kann sich kein Unternehmen leisten, sie muss unbedingt verhindert werden», findet Lorenz Ramseyer, Berater aus Kerzers FR und selbst seit 15 Jahren remote tätig. «Hybrides Arbeiten funktioniert nur, wenn alle gleichwertig sind», betont der Projektleiter, der zugleich Präsident des Vereins Digitale Nomaden Schweiz ist.
Diese Gleichwertigkeit zwischen Arbeitenden im Büro und daheim herzustellen, ist allerdings nicht einfach. Denn Menschen tendieren zu etwas, das Psychologen den Proximity Bias nennen: Sie bevorzugen Menschen in ihrer physischen Nähe. Deshalb neigten Vorgesetzte in der Vergangenheit auch dazu, Bürokräfte bei Beförderungen zu bevorzugen.
Damit eine hybride Arbeitswelt funktioniert, muss diese Diskriminierung beendet werden. Wer zu Hause bleibt, darf nicht unsichtbar sein. «Gesehen werden ist auch digital möglich», betont Barbara Josef, Mitgründerin der Organisationsberatung 5–9 in Pfäffikon SZ. Die technischen Voraussetzungen dafür hätten viele Firmen mit Plattformen wie Teams, Slack oder Beekeeper geschaffen.
Präsent sein trotz Remote Work
Es gibt zahlreiche Tricks, um Heimarbeiterinnen und -arbeiter präsenter erscheinen zu lassen. Experten raten zum Beispiel, bei Videocalls grosse Bildschirme zu verwenden und die Remote-Teilnehmenden nicht nur als kleine Kacheln, sondern im Vollbild einzublenden. Allein dadurch wirken die Zugeschalteten für die Kollegen im Büro präsenter. Doch solche Massnahmen allein reichen nicht.
Damit Remote-Kräfte wirklich sichtbar sind, brauche es eine «neue Haltung», wie Organisationsexpertin Josef es ausdrückt. Sie gibt ein Beispiel: Früher informierte man seine Kollegen, wenn eine Aufgabe abgeschlossen war. Doch wer sich so im Homeoffice verhält, bleibt über lange Strecken unsichtbar. «Besser ist, häufig Zwischenergebnisse zu präsentieren, bei Kollegen nachzufragen – oder deren Fragen zu beantworten», rät Josef. Über digitale Plattformen lasse sich Wissen sehr gut vorausschauend teilen – und mit mehr Personen als über eine physische Sitzung.
Remote-Arbeit als Geben und Nehmen beider Seiten
«Extrem wichtig ist auch, Entscheidungen transparent zu machen», ergänzt Remote-Profi Ramseyer. Heisst: Büromenschen dürfen Dinge nicht mehr unter der Hand aushandeln – etwa auf dem Weg in die Cafeteria –, sondern sollten immer alle Entscheidungsträger beteiligen, egal wo sie sitzen. Ausserdem müssen sämtliche Entscheidungen schriftlich dokumentiert werden, sodass auch Homeoffice-Kollegen sie einsehen können.
«Das wird ein Kampf gegen die Bequemlichkeit», räumt Ramseyer ein. Damit der Graben zwischen Offline- und Online-Kollegen nicht zu tief wird, brauche es zudem regelmässige Treffen, ergänzt Psychologe Schulze. «Die Regeln dazu können zum Beispiel in einer Team-Charta festgelegt werden.»
Doch um eine Zweiklassengesellschaft in den Unternehmen wirklich zu verhindern, braucht es ein Umdenken. «Homeoffice wurde lange Zeit als Goodie behandelt», erklärt Organisationsexpertin Josef. Dieses Image von der Heimarbeit als Belohnung für verdiente Kräfte müsse aus den Köpfen verschwinden. «Es geht darum, zu verstehen, dass Remote-Arbeit ein Geben und Nehmen ist. Die Mitarbeitenden gewinnen persönliche Flexibilität, doch dafür müssen sie zum Beispiel auch einmal bereit sein, morgens um halb sieben einen Call aus Asien anzunehmen.»
Weitere News aus Wirtschaft, Politik und Finanzen finden Sie hier: https://fal.cn/Xing_HZ_Home
Unsere Abos finden Sie hier: https://fal.cn/Xing_HZ_Abo
Mit dem Digital-Abo von Handelszeitung und BILANZ werden Sie umfassend und kompetent über alle relevanten Aspekte der Schweizer Wirtschaft informiert

