Russlands Revanche: Auf einen möglichen Gaslieferstopp ist Europa nicht vorbereitet
Russland kündigt weiteren Gas-Abnehmern im Westen die Lieferungen. Jetzt wächst die Angst, dass Putin als Reaktion auf das Ölembargo noch andere EU-Staaten abklemmt.
Erst Polen und Bulgarien, dann Finnland, jetzt die Niederlande und Dänemark: Der russische Energiekonzern Gazprom stellt nach und nach seine Gaslieferungen an Staaten der EU ein. Das nährt in Europa die Sorge vor einem kompletten Lieferstopp, der gravierende ökonomische Folgen hätte. Die Vorbereitungen auf den Ernstfall laufen, doch sie sind noch lange nicht abgeschlossen.
Jetzt Handelsblatt Premium zum Vorteilspreis sichern - Zum Angebot
Die Versorgungssicherheit war am Montag und Dienstag eines der beherrschenden Themen beim EU-Gipfel in Brüssel. „Die Vorsorge für größere Unterbrechungen des Angebots und die Widerstandsfähigkeit des EU-Gasmarktes sollten verbessert werden“, stellen die Staats- und Regierungschefs in ihrer gemeinsamen Erklärung klar.
Auch die EU-Kommission fordert ein schnelles Handeln: „Angesichts der mangelnden Zuverlässigkeit der russischen Energielieferungen sind dringend Vorkehrungen geboten“, heißt es in deren vor zwei Wochen veröffentlichten Repower-EU-Strategie.
Unabhängige Energieexperten teilen die Sorgen der EU. „Europa muss sich auf mögliche Vergeltungsmaßnahmen vorbereiten“, sagt Simone Tagliapietra vom Brüsseler Institut Bruegel. „Hierfür ist eine starke EU-Koordinierung erforderlich, um Vorsorge für die potenzielle Unterbrechung aller russischen Gaslieferungen nach Europa zu treffen.“
Gas ist das letzte wirtschaftliche Druckmittel, das dem Kreml noch bleibt. Und da Brüssel mit den beschlossenen Sanktionen gegen russisches Öl und russische Kohle selbst Energie als Waffe einsetzt, wächst die Gefahr, dass Russland zurückschlägt.
Gazprom stellt nach und nach Gaslieferungen nach Europa ein
Sollte Deutschland oder die gesamte EU nicht mehr beliefert werden, würden die wirtschaftlichen Konsequenzen deutlich über das hinausgehen, was die bisherigen Lieferstopps verursacht haben. Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen die Vorbereitungen darum intensivieren. Sie wollen bilaterale Solidaritätsvereinbarungen und einen europäischen Notfallplan.
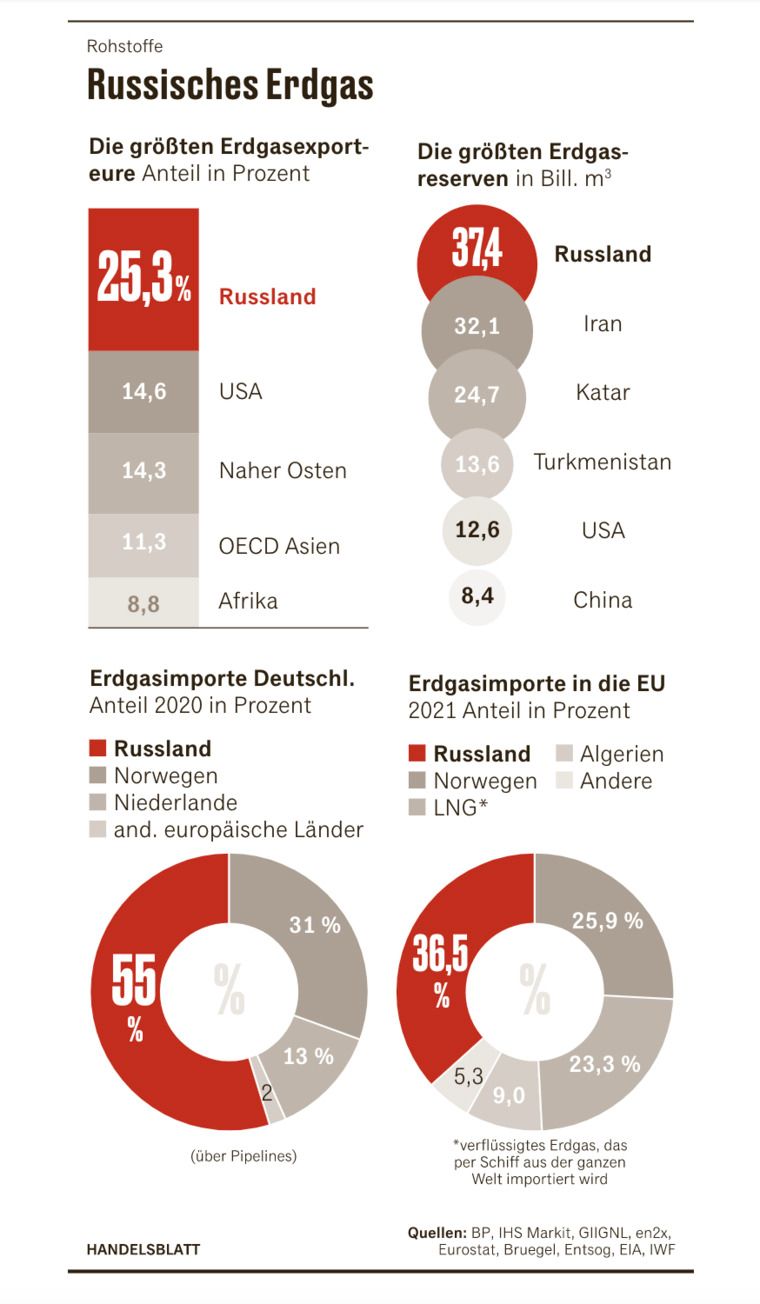
Beides ist noch nicht fertig. Beschlossen ist lediglich, dass bis zum Winter die Gasspeicher in der EU gut gefüllt sein müssen. Woher das Gas dafür bei einem Stopp der Gasexporte aus Russland kommen soll, ist unklar.
Russland droht bereits seit Wochen deutlich damit, Gaslieferungen einzustellen. Präsident Wladimir Putin unterzeichnete Ende März ein Dekret, laut dem europäische Gaskunden ihre Zahlung in Rubel leisten müssen. Europäische Gaskunden zahlen daher nun in Dollar oder Euro auf ein Konto bei der Gazprombank ein, die dieses Geld auf ein weiteres Konto transferiert, wobei der Betrag in Rubel umgetauscht wird.
Die EU-Kommission betont aber, dass europäische Unternehmen den Tausch nicht selbst veranlassen dürfen, weil sie dabei ein Geschäft mit der russischen Zentralbank machen müssten, die unter Sanktionen steht. Die Brüsseler Beamten empfehlen den Energieunternehmen, die Konten einzurichten, das Geld in Euro zu überweisen und dann zu erklären, dass die Zahlung abgeschlossen sei. Der Umtausch solle dann nicht mehr Sache der europäischen Firmen sein.
Gazprom: Shell und Orsted erhalten kein Gas mehr aus Russland
Unternehmen aus Polen, Bulgarien und Finnland, die sich nicht auf die neuen Bedingungen einlassen wollten, werden schon nicht mehr beliefert. Am Montag erklärte auch der niederländische Gashändler Gasterra, er richte keine neuen Konten ein. Seit Dienstag werden die Niederlande nicht mehr beliefert.
Auch der dänische Versorger Orsted wollte sich nicht auf das Konstrukt einlassen – und erhielt prompt die Quittung: Von diesem Mittwoch an will der russische Staatskonzern Gazprom dem Unternehmen kein Gas mehr liefern. Auch der Großabnehmer Shell Energy Europe soll keine Lieferungen mehr erhalten, weil er die Rechnungen nicht – wie von Moskau gefordert – in Rubel bezahlt habe, teilte Gazprom mit.
Die deutschen Energieimporteure wie Uniper haben in Absprache mit der Bundesregierung geplant, das Zwei-Konten-Modell zu nutzen. Bis Ende März müssen die Zahlungen erfolgt sein, hieß es mehrfach. Ob Unternehmen bereits Zahlungen so geleistet haben, dass sie von Gazprom akzeptiert werden und gleichzeitig nicht gegen EU-Sanktionen verstoßen, ist bislang unklar.
Alle bisher betroffenen Länder können sich aus anderen Quellen versorgen und haben die Umstellung bewusst hingenommen. Gasterra erklärte allerdings schon, es lasse sich nicht vorhersagen, „ob der europäische Markt diesen Lieferausfall ohne schwerwiegende Folgen auffangen kann“. Das Unternehmen hätte bis Ende September noch mit zwei Milliarden Kubikmetern Gas aus Russland versorgt werden sollen.
Orsted dagegen betonte, dass es weiterhin russisches Gas auf dem europäischen Markt einkaufen könne. In Bezug auf die Versorgungssicherheit verwies es unter anderem auf seine Gasspeicher in Deutschland.
Deutschland auf Gas-Lieferstopp noch nicht ausreichend vorbereitet
Für Deutschland wäre es nicht möglich, schnell auf andere Anbieter umzusteigen. Damit im Winter genug Gas zum Heizen vorhanden ist, müsste der Staat eingreifen. Zuerst würden mit Gas betriebene Kraftwerke abgeschaltet und stattdessen Kohlekraftwerke hochgefahren. Wer danach vom Netz getrennt würde, hat die Bundesnetzagentur noch nicht festgelegt, obwohl die Wirtschaft danach verlangt.
Nach einer Umfrage unter den 2500 größten Verbrauchern in der Industrie veröffentlichte die Behörde lediglich eine Liste mit Kriterien, nach denen in einer Gasnotlage entschieden werden soll. Darunter finden sich Punkte wie die Größe der Industrieanlage, die zu erwartenden Schäden, Kosten und Dauer einer Wiederinbetriebnahme und die Bedeutung der Anlage für die Allgemeinheit. In einer Stellungnahme verwies die Bundesnetzagentur darauf, „allenfalls eine Unterscheidung nach Branchen“ durchführen zu können. Entscheidungen für jeden einzelnen Fall seien nicht möglich.
Experten finden diese Herangehensweise problematisch. Die Umfrage habe einen gewaltigen Datensatz hervorgebracht, mit dem die Netzagentur theoretisch genau auswählen könnte, welches Unternehmen noch Gas erhält, sagt Franziska Lietz, Anwältin bei der Rechtskanzlei Ritter Gent. Wenn die Behörde die vorliegenden Daten nicht nutze und stattdessen pauschale Entscheidungen treffe, sei das juristisch angreifbar. „Das kann vermeidbare hohe wirtschaftliche Schäden und eine Klagewelle verursachen“, warnt Lietz.
In der Industrie käme es in diesem Fall mit hoher Sicherheit zu Produktionsausfällen und in Deutschland zu einer Rezession. Schätzungen zufolge würde das deutsche Bruttoinlandsprodukt im Verlauf eines Jahres drei bis zwölf Prozent geringer ausfallen. So warnt auch Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI): „Eine Unterbrechung russischer Gasexporte würde das Wachstum in Europa abwürgen und unsere Wirtschaft in die Rezession schicken.“
Thyssen-Krupp-Manager: Verfügbarkeit von Gas ist wichtiger als der Preis
Den Unternehmen bleibt nichts übrig, als sich auf den Ernstfall bestmöglich vorzubereiten. Bei BASF etwa gibt es einzelne Anlagen, die heruntergefahren werden können, um anschließend dort normalerweise produzierte Stoffe wie Ammoniak von anderen Quellen zu beziehen. Der Effekt wäre spürbar, weil der Gasverbrauch bei der Produktion sehr hoch ist.
BASF und andere große Chemiehersteller sind in ihren Krisenplänen zu dem Schluss gekommen: Ein Rückgang der gesamten Gasversorgung um weniger als 50 Prozent wäre durch interne Maßnahmen verkraftbar. Geht der Ausfall darüber hinaus, müssten in großem Stil Anlagen stillgelegt werden. Dabei würden Lieferketten abreißen, was hohe Risiken für die Gesamtwirtschaft mit sich bringt.
Schlimmer noch würde sich ein abrupter Stopp von Gaslieferungen auswirken. Gerade in der energieintensiven Metallindustrie hätte dies einen sofortigen Stillstand der Produktion zur Folge und könnte einzelne Anlagen dauerhaft zerstören.
Dies ist laut Bernhard Osburg, Stahlchef bei Thyssen-Krupp, aber nicht das größte Problem. „Wichtiger als die Frage nach der Höhe des Erdgaspreises ist die Verfügbarkeit“, sagt er. „Viele unserer Anlagen müssten vor einem Betrieb mit LNG umgerüstet werden.“
Wenn das bei allen Herstellern gleichzeitig passieren soll, wäre das eine große Herausforderung, warnt er. „Können wir weniger als 50 Prozent unseres aktuellen Gasbedarfs decken, wird es schwierig, eine stabile Produktion aufrechtzuerhalten“, sagt Osburg. Das bedeute für ein hohes Risiko, auch weil viele Anlagen auf einen Dauerbetrieb ausgelegt seien. „Eine Kokerei beispielsweise lässt sich nicht kurzfristig abstellen, ohne dass es große wirtschaftliche Schäden verursacht.“

