„Staat überhitzt den Arbeitsmarkt“: Warum weniger Beamte die Lösung sein könnten
Der Staat hat die Arbeitskräfteknappheit verstärkt und die Arbeitsmärkte überhitzt – er sollte sich zurückziehen. Ein Gastbeitrag.
Die Backstube um die Ecke, die keinen Bäcker findet, und das Restaurant im Stadtzentrum, dem der Kellner fehlt – der Mangel an Arbeitskräften in Deutschland ist allgegenwärtig. Und das, obwohl die Wirtschaft stagniert. Als Grund wird häufig die Alterung der Bevölkerung genannt. Das Institut der Deutschen Wirtschaft warnte bereits 2022, dass bis zum Jahr 2035 die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 53,1 Millionen auf 50,1 Millionen schrumpft. Das Statistische Bundesamt merkt an, der demografische Wandel sei eine der Ursachen für die zunehmende Knappheit an gut ausgebildeten Fachkräften.
Können wir die Arbeitskräfteknappheit also der Demografie anlasten?
Klar ist: Die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt haben sich geändert. Seit Ende der 1960er-Jahre hatte der Trend bei den offiziell registrierten Arbeitslosen in Westdeutschland lange nach oben gezeigt. 1997 gab es 2,9 Millionen Arbeitslose, im von der Privatisierung der volkseigenen Betriebe gebeutelten Osten Deutschlands kamen weitere 1,6 Millionen hinzu. 2005 erreichte die Arbeitslosenquote einen Rekord von 11,0 Prozent in West- und 20,6 Prozent in Ostdeutschland.
Weil die Arbeitslosigkeit die Sozialkassen in die roten Zahlen trieb, sah sich die Regierung von Kanzler Gerhard Schröder 2003 gezwungen, den Arbeitsmarkt zu reformieren. Einschnitte bei den Sozialleistungen erhöhten den Druck zur Arbeitsaufnahme, ein neu geschaffener Niedriglohnsektor brachte die Arbeitskräftenachfrage in Schwung. Der Erfolg der Reformen stellte sich allerdings erst unter Schröders Nachfolgerin Angela Merkel ein.
Merkel drehte Teile der Agenda 2010 wieder zurück und weitete die Beschäftigung im öffentlichen Sektor aus. Das Geld dafür kam von der Europäischen Zentralbank (EZB). Indem diese im Gefolge der Finanzkrise ab 2008 die Zinsen senkte und Staatsanleihen kaufte, spülte sie viel Geld in die Staatskassen. Auch immer mehr staatliche Regulierungen ließen die Nachfrage nach Arbeitskräften wachsen.
👉 Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen
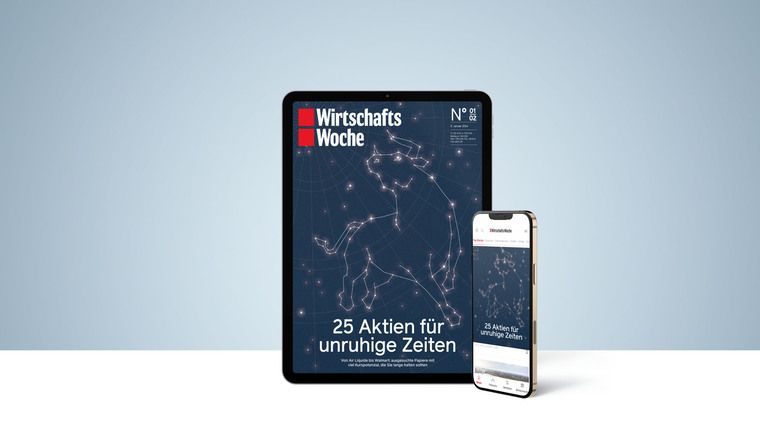
Die Anzahl der Erwerbstätigen nahm von 40,8 Millionen im Jahr 2008 auf zuletzt 46,1 Millionen zu. 2,7 Millionen Jobs entstanden im öffentlichen Dienst (einschließlich Gesundheits- und Bildungssektor), 1,3 Millionen in freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen, davon viele bei öffentlichen Forschungseinrichtungen, Gleichstellungsstellen, Unternehmensberatungen und Umweltberatern.
In der Industrie, wo der Wohlstand in Deutschland geschaffen wird, ist die Beschäftigung hingegen weitgehend konstant geblieben. Den Rückgang in der Coronakrise verhinderte der Staat durch großzügiges Kurzarbeitergeld sowie – generell – durch üppige Fördergelder und Subventionen.
Der Beschäftigungszuwachs der vergangenen Jahre speiste sich zu einem großen Teil aus zuvor nicht berufstätigen Frauen und Rentnern sowie Zuwanderern. Die Demografie, die ihre Wirkung erst sehr langsam entfaltet, kann daher nicht der Grund für die plötzliche Überhitzung des Arbeitsmarktes sein.
Ursächlich ist vielmehr der Staat. Er hat nicht nur die Nachfrage nach Arbeitskräften auf ungesunde Weise nach oben getrieben. Er hat auch mit großzügigen Sozialleistungen wie der Rente mit 63, dem Bürgergeld und Beschränkungen bei der Arbeitsaufnahme von Zuwanderern das Angebot auf dem Arbeitsmarkt verknappt. Laut offizieller Statistik sind 4 Millionen der 5,5 Millionen Bürgergeldempfänger erwerbsfähig. Die Anzahl der Studenten ist seit 2008 von 1,9 auf 2,9 Millionen gestiegen, während die der Lehrlinge von 2,0 Millionen auf 1,2 Millionen gefallen ist. Darüber hinaus bindet der Staat mit Zuwendungen Arbeitskräfte in nicht wettbewerbsfähigen Unternehmen und in Nichtregierungsorganisationen.
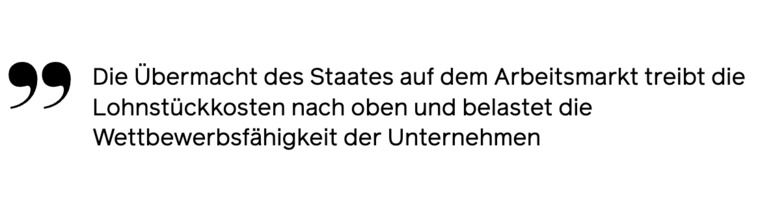
Dadurch hat er die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer über ein gesundes Maß hinaus gestärkt. In Reaktion auf die hohe (gefühlte) Inflation fordern die Gewerkschaften Lohnerhöhungen, die jenseits der durch Regulierung ausgebremsten Produktivitätsgewinne liegen. Angesichts einer vorbildlichen Work-Life-Balance beim Staat sind die privaten Unternehmen mit ähnlichen Forderungen konfrontiert. Die Übermacht des Staates auf dem Arbeitsmarkt treibt die Lohnstückkosten nach oben und belastet die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen.
Die Gefahr ist groß, dass der aus den rasant steigenden Lohnstückkosten resultierende Abbau von Arbeitsplätzen in Industrie und Dienstleistungssektor die Politik dazu veranlasst, die Beschäftigung beim Staat weiter zulasten der Unternehmen auszubauen und dies mit Hilfe der Notenbank zu finanzieren.
Besser wäre es, der Staat zöge sich aus dem Arbeitsmarkt zurück. Die anstehende Welle von Eintritten in den Ruhestand eröffnet ihm einen sozialverträglichen Weg dorthin.
👉 Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen
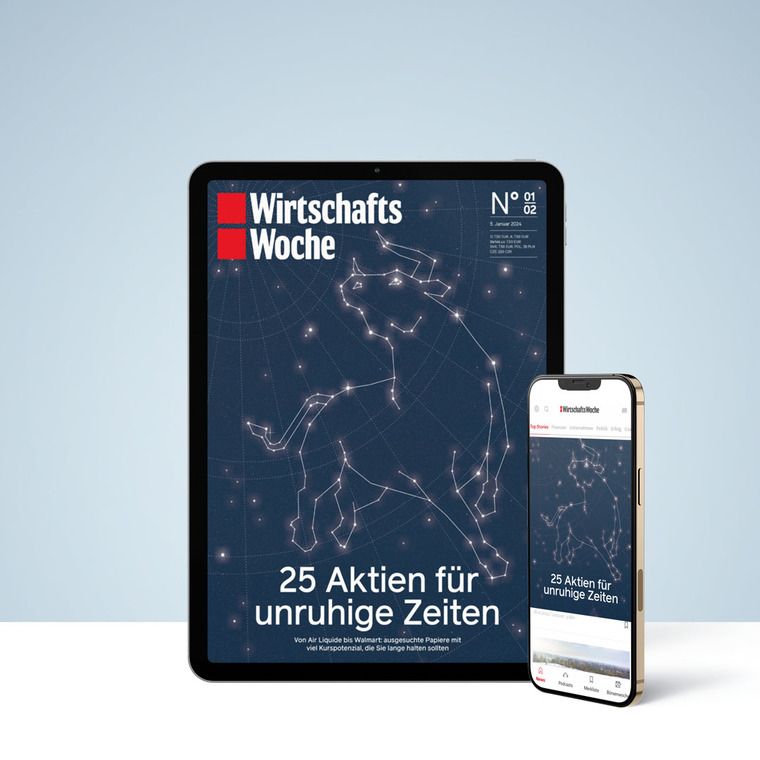
👉 Exklusiv bei XING: 6 Wochen die WirtschaftsWoche kostenlos lesen

