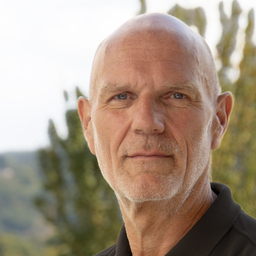Sind wir bereit für mehr Fairness?
Reflexions- und Handlungsimpuls
Fairness ist im Grunde ein einfaches Prinzip, zugleich ist es eine sehr individuelle Vorstellung und ein ebensolches Bedürfnis. Fairness ist der in der Welt der Ökonomie selten realisierte Traum von gerechtem, ehrlichem, anständigem Verhalten. Es ist der Wunsch danach, für alle Seiten einen gleichermaßen befriedigenden Konsens und damit gleichwertige Bedingungen zu schaffen. Ziel ist, einen Zustand herzustellen, der weder für die Beteiligten, noch die Unbeteiligten, die Allgemeinheit oder zukünftige Generationen Nachteile bietet, mithin also einen Zustand, in dem zum Beispiel Ressourcen nur insoweit genutzt werden, wie sie sich selbst regenerieren oder in angemessener Zeit regeneriert werden können.
Auch wenn in der Wirtschaft und vielfach in unserem Arbeitsleben im „Kleinen“ oftmals versucht wird, fair miteinander umzugehen, (mindestens) bei einem Blick auf größere Unternehmen ist Fairness in meiner Wahrnehmung ein eher rares Gut.
Wohl vor allem der von Alfred Rappaport und Joel Stern Mitte der 1980’er Jahre entwickelte und propagierte Ansatz des Shareholder Value - heute auch gerne „value based view“ = „wertbasierte Sicht“ genannt - ist heute fast schon dogmatisch in vielen Unternehmen präsent. Ökonomische, soziale oder gar ökologische Fairness tritt in diesem Modell bestenfalls indirekt als Wertgenerator und mittelbares Ziel auf.
Im Ergebnis ist oftmals ein System entstanden, das, um (vorgeblich) der Zielsetzung eines maximalen Unternehmensprofits sicherzustellen versucht, individuelle Zielsetzungen so zu bündeln, dass der erreichbare Unternehmensprofit optimiert wird. Es ist der Versuch, Synergien greifbar zu machen. Ein Versuch, der im Großen bei Fusionen und Übernahmen in der Vielzahl scheitert und im Kleinen selten gelingt.
Die Frage ist, was tatsächlich skalierbar, realistischerweise und zugleich „fair“ möglich ist, um den Unternehmenswert und den Gewinn sicherzustellen oder gar zu steigern. Fairness ist an dieser Stelle ein durchaus beachtenswerter Ansatz. In den letzten Jahren wird die wachsende Bedeutung globaler, systemischer Zusammenhänge immer klarer. Es wird immer deutlicher, dass, was und wie wir Dinge tun, Wirkung besitzt. Wirkung, die weit über das hinausgeht, was im individuellen oder organisationalen/unternehmerischen auf den ersten Blick zumeist wahrgenommen wird. Und Wirkung, die zunehmend daran gemessen wird, wie „fair“ sie von Kunden wahrgenommen wird.
Doch diese Wirkung, diese Fairness, ist auch immer relativ. Es gibt und das ist wichtig zu verstehen, keine absolute Fairness, kein unbedingtes „gerecht, ehrlich und anständig“. Fairness ist immer vom Umfeld, von der Kultur, den Menschen und den Gegebenheiten abhängig. Schwierig wird es, wenn die wahrgenommene Fairness des oder der einen, also die individuell als absolut wahrgenommene Fairness, auf andere appliziert wird. Wenn „meine Fairness“ auch deine „Fairness sein“ muss. Den Unterschied zu verstehen, bedenken und anwenden zu können, bedarf eines vergleichsweise umfassenden und systemischen Verständnisses.
Zurück zur Fairness in Unternehmen. Der Versuch, die Synergien individueller Zielerreichungen zu nutzen, hat oftmals zu einem mindestens komplizierten, manchmal auch kaputten und korrupten System geführt. Individuelle Leistung wird (mehr oder weniger) honoriert und dabei oft stärker belohnt als die gemeinsame Arbeit an gemeinsamen Zielen. Und auch wenn es in einigen (gerade großen Unternehmen) en vogue ist, anzukündigen, Fairness und Nachhaltigkeit im Handeln und der Ausrichtung stärker zu verankern, wenn Werte nach außen hin hochgehalten und kommuniziert werden, passiert nach diesen Ankündigungen meist lange Zeit wenig. Fairness und ebenso Nachhaltigkeit und viele andere vorgebliche Unternehmenswerte sind, so scheint es, vor allem PR, Corporate Social Responsibility und Employer Branding Themen.
Dabei sind wir zunehmend angewiesen auf Fairness. Fairness in ökologischer, sozialer und auch ökonomischer Hinsicht. Noch mehr, wir brauchen mehr Nachhaltigkeit in all diesen Komponenten, die auch auf einem bewussteren Umgang mit Fairness gründet.
Im Bewusstsein, dass Fairness relativ ist, dass zugleich globale systemische Zusammenhänge an Bedeutung gewinnen und wir heute die Voraussetzungen für das Leben und Überleben späterer Generationen schaffen, im Bewusstsein, dass die gesellschaftliche Schere heute schon zu weit geöffnet ist und das wirtschaftliche Gefälle sich weltweit verändert, sollten wir darüber nachdenken, wie wir persönlich handeln und organisationale Strukturen schaffen können, die mehr Fairness, Nachhaltigkeit und zugleich gemeinsamen Gewinn an Wissen, Kompetenz und sozialer, ökologischer UND ökonomischer Überlebensfähigkeit erlauben. Für den einzelnen, das Unternehmen und die Gesellschaft!
Aus meiner Sicht sind, um einen solchen Schritt zu gehen, vergleichsweise wenigen Elemente notwendig, die allerdings signifikanten Einfluss besitzen. Damit Dinge als fair wahr- und angenommen werden können, braucht es Vertrauen, es braucht das Gefühl eines ausgewogenen Verhältnisses von Geben und Nehmen, es braucht Zuversicht, Sicherheit und Entscheidungsfreiheit und es braucht den Mut und auch ein wenig die Weisheit, diese großen Zusammenhänge zu erkennen und danach zu handeln. Anders ausgedrückt, es braucht persönliche Reife, die persönliche Bereitschaft derer, die die Weichen stellen wollen und können. Dies ist im kleinen jeder von uns. In Unternehmen scheinen es diejenigen zu sein, die über Ziele, Richtungen und Wege entscheiden. Doch damit sind auch hier wieder wir alle gefragt. Um bei den Entscheidern dieses Bewusstsein stärker zu wecken und Möglichkeiten aufzuzeigen ist es die Aufgabe aller, dies in Dialogen zu thematisieren, ethische Fragen einzubringen, Ressourcen bedachter zu nutzen, den sozialen, ökologischen und ökonomischen Fußabdruck zu betrachten und die Qualität der Arbeitsergebnisse vor dem Hintergrund dieser drei Blickwinkel immer wieder zu überprüfen.
Eine so umfassenden Perspektive lässt sich in bestehenden Strukturen kaum kurzfristig umsetzen oder und anwenden. Diese einzubringen, ist Teil eines Entwicklungsweges. Es ist Teil von dem, was „Next Management“, als Grundprinzip eines neuen organisationalen Handelns ist. Es ist Teil eines Weges, der helfen kann, die Zukunft auf eine Weise zu gestalten, die langfristiges und nachhaltiges (Über)Leben von Unternehmen einfacher macht. Und es ist für mich außer Frage, dass dies ein Ziel und eine Aufgabe ist, die uns alle angeht.